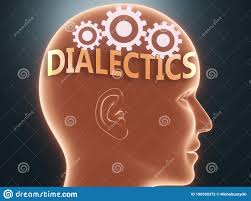Die Dialektik ist ein sehr alter und gleichzeitig sehr vieldeutiger Begriff in der Philosophie. Man kann sich Folgendes darunter verstehen:
Die grundsätzlichste aller Bedeutungen meint schlicht die Wechselrede im Dialog; Dialektik als Hin und Her zwischen meist zwei, selten mehreren Gesprächspartnern und, als etwas verfeinerte Bestimmung, die Gegenbewegung zweier inhaltlichen Positionen, die im Gespräch vertreten werden. Im Idealfall befeuern sich diese Pole gegenseitig, so dass aus ihrer vielleicht zunächst konträr (er)scheinenden Position eine synthetisierende Mitte entsteht.
Die modernste Art des Verständnisses impliziert eine dialektische Logik – dann bedeutet “Dialektik” den logischen Ansatz, dass es “wahre Kontradiktionen” gibt: d.h. Sätze der Form “a und nicht-a sind gleichzeitig der Fall” können als logisch gültig angesehen werden. Diese Art der Logik nennt sich auch “Parakonsistente Logik”.
Sehr interessant, wenn auch überaus komplex ist die Dialektik, die man vielleicht als metaphysisch bezeichnen könnte: hierbei geht man davoon von der Annahme aus, dass es in der Sprache und im Denken Strukturen gibt, bei denen ein Begriff mit seinem Gegenbegriff untrennbar verbunden ist. Das Ziel dabei ist, diese Strukturen herauszuarbeiten, und dabei die Art der gegenseitigen Bedingung eines Begriffs mit seinem Antonym möglichst genau zu untersuchen.
Viele Philosophen haben sich bereits mit diesen dialektischen Strukturen beschäftigt. Platon steht hier an allererster Stelle, sowohl chronologisch als auch hinsichtlich seiner Relevanz; Bei Platon ist die Dialektik das zentrale Strukturmoment der Philosophie. Hegel könnte man den Extremisten der Dialektik nennen: bei ihm ist sie ebenso wie bei Platon der Motor seines Denkens, aber in wesentlich schärferem und dezidierterem Sinne. Bei Wittgestein schließlich ist die dialektische Haltung nicht an der Oberfläche; aber in seinem Spätwerk, den “Philosophischen Untersuchungen, besonders aber “In Gewissheit” kann man starke dialektische Tendenzen ausmachen. Hier findet die Dialektik aus den metaphysischen Höhen, der abstrakten Eiswüste des Hegel’schen Denkens wieder einen etwas konkreteren Boden.
Wer sich dafür interessiert, kann sich hier eine kurze, aber trotzdem anspruchsvolle Einleitung in das Thema ansehen (bzw. einfach weiterlesen). Das Besondere am modernen Verständnis der Dialektik (der parakonsistenen Logik) ist, dass sie einen ganz neuen Horizont von Denken im Allgemeinen und logischem Schließen im Besonderen aufreißt. Interessanterweise kann man auch die Position vertreten, dass Platon und Hegel, mit ihrer jeweiligen Art, die Dialektik als philosophisches Werkzeug einzusetzen, ebenfalls die üblichen Pfade des Denkens und Argumentierens sowie des rational gültigen Folgerns verlassen und einen Blick über die Grenze der Konsistenz, also der Widerspruchsfreiheit hinaus wagen, von der einige moderne Philosophen glauben (so auch ich), dass sie eine künstliche, und schon gar nicht notwendige Beschränkung ist. Dialektik, im altertümlichen, wie im modernen Sinne qualifiziert sich damit zu einer sowohl umfassenderen als auch in sich kohärenteren Art und Weise des Denkens als die althergebrachte.
Platon, Hegel, und der Anfang des Denkens im Widerspruch …
1. Einleitung
Der Anfang der Philosophie birgt eine Verlegenheit in sich. Diese stellt sich in der einfachen Frage, womit der Anfang gemacht werden soll. Dass die Antwort darauf, so simpel auch die Fragestellung erscheinen mag, nicht ebenso kurz wie die Frage sein kann, lässt sich vermuten, wenn man zwei Klassiker der Philosophiegeschichte aufschlägt: Platons „Parmenides“ und Hegels „Wissenschaft der Logik“ . Beide widmen dieser Frage – in der einen oder anderen Ausprägungsart, ausdrücklich oder implizit – einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Werke. Der zweite Anhaltspunkt für die philosophische Tiefe dieser Frage ergibt sich, wenn man auf ihren geschichtsphilosophischen Kontext projiziert: Wo, wie und mit welcher Rechtfertigung haben die großen Philosophen ihre Anfangspunkte gesetzt? Gleich auf der ersten Seite des ersten Buches des ersten Teils der Wissenschaft der Logik gibt Hegel in schneller Folge einige Beispiele an: „das Wasser, das Eine, Nus, Idee, – Substanz, Monade, usf.;“ und unterschlägt damit einen nicht unwesentlichen Punkt: denn wenn Thales das Wasser als Grundstoff alles Seins (und damit auch alles Philosophierens, weil es ja sein Ansatzpunkt ist) setzt, ist dieser Ansatz doch grundsätzlich verschieden von beispielsweise Platons Ideen – Hegel führt sie aber in gleichwertiger Aufzählung an. Thales belässt den Anfang in der stofflichen, materiellen Welt – während Platon diesen in ein Prinzip abstrahiert, ihn in die Sphäre der Ideen sublimiert. Dieser Unterschied ist grundlegend und von hoher Wichtigkeit: Denn wenn Wasser (oder die anderen Elemente der Vorsokratiker) als Urgrund aller Dinge herhalten muss, mag zwar über die Richtigkeit und Legitimation dessen gestritten und philosophiert werden – aber wenn ein abstraktes philosophisches Konzept an dessen Stelle tritt, wird ein völlig neues Niveau des philosophischem Diskurs erschlossen, weil ab jetzt zwei Dinge auf zunächst noch unbestimmte Art und Weise verwoben zu sein scheinen: Das Denken und das Sein. Denn nur wer Platons Konzept der Ideen verstehen kann, erfasst letztlich (die Richtigkeit der Ideenlehre natürlich vorausgesetzt) auch das Sein als solches, weil es sich aus den Ideen ableitet. Mit diesem Ansatz, nämlich das organisierende Prinzip des Seins von der unmittelbar gegeben Welt, der Materie, weg in das Reich des Denkens abstrahierte, gab Platon den Grundton für beinahe alle philosophischen Strömungen vor, die auch noch heute das Denken der Philosophen beflügeln. Und letztlich befeuert er damit auch den nächsten Schritt, dessen Ausarbeitung Hegel sein Lebenswerk gewidmet hat: dem Versuch, „das subjektive Tun …“, also die Prozesse, die beim menschlichen Erfassen, Verstehen und Erkennen eine Rolle spielen, „als wesentliches Moment der objektiven Wahrheit …“ zu erfassen. Denn für Hegel genügt es nicht, eine ewige, unwandelbare Ideenwelt als Urgrund alles Seins und Denkens über das Sein zu veranschlagen – er will einem neuen Ansatz folgen, nämlich dass im Erkenntnisakt selbst die Wahrheit über das Sein zu suchen und zu finden ist, und deshalb dort aller Dinge Anfang liegt. Er reflektiert also den Wahrheitsgehalt der Erkenntnis zurück auf den Erkenntnisakt.
Aus einem ironisierenden Blickwinkel betrachtet könnte man hiergegen einwenden, dass wir uns einmal im Kreis gedreht hätten: bei der Frage nach dem Anfang der Erkenntnis blickten wir zuerst hinaus in die Welt und versuchten, sie sich aus sich selbst zu erklären. Dann sahen wir hinauf und behalfen uns mit einer entfernten, abstrakten, unsichtbaren Welt. Und schließlich ließen wir diese Welt wieder in unseren Kopf Einzug halten und reflektierten letztlich also wieder nur über uns selbst. Wenn wir ausschließlich eine solche abstrakte, schwer fassbare Sphäre zur Erklärung verwenden, können wir einfach ansetzen, dass sie sich aus sich selbst entwickelt oder sowieso schon immer da war? Oder wenn wir, im anderen Fall, letztlich nur über uns selbst reflektieren, kann auf diese Art und Weisen überhaupt ein Anfang von irgendetwas gemacht werden?
Wie wir noch sehen werden, steckt in diesen Fragen ein gutes Stück Wahrheit. Denn eben diese Schritte bereiten sowohl Platon als auch Hegel einiges an Kopfzerbrechen. Letztlich muss auch Hegel (sowie Platon) sein Philosophieren mit etwas Gegebenem beginnen. Freilich verwendet er nichts Konkretes, sondern hält sich an abstrakte Begriffe, respektive platonischen Ideen. Aber wenn letztlich beim Umgang mit diesen Begriffen die rein gedankliche Bewegung, das Wirken des Verstandes das Ausschlaggebende ist, dann scheint der Einwand berechtigt: Falls über nichts direkt Gegebenes, „Äußeres“ reflektiert wird, warum überhaupt, und woher, kommt der erste, anfängliche Schritt im Denken? Soll sich die Bewegung im Geiste, die ja gerade betrachtet werden soll, selbst anstoßen? Wenn nein, wie kann dann nur die Bewegung als solche, isoliert von äußeren Einflüssen betrachtet werden (da ja in diesem Falle ein äußerlicher Angriffspunkt vonnöten wäre)? Und wenn ja, wird sie dann nicht inhaltsleer? Oder, wenn im anderen Falle, Platon nur die Ideenwelt als Erklärungsgrund respektive Angriffspunkt verwenden will – wie soll eine Sphäre, wo die Ideen unwandelbar und selbstgenug nebeneinander sitzen, sich aus sich selbst heraus entfalten, und dann auch noch eine Erklärungsleistung für die diesseitige Welt abgeben?
Wohlgemerkt: diese Fragestellungen bilden einige mögliche Formulierung der Problematik, die sowohl Platon als auch Hegel beschäftigt. Wir werden während unserer Betrachtungen noch auf mehrere andere Ausprägungsarten stoßen. Doch jeder dieser verschiedenen Blickwinkel wird uns helfen, das Grundproblem immer genauer umreißen zu können; dies wird ersichtlich werden, wenn wir ganz am Schluss zu einen ansatzweisen Vergleich der Ausprägungsarten der Problematik bei Platon und Hegel anführen.
Parmenides: „Wenn Eins ist …“
Es mag vielleicht etwas ungerechtfertigt erscheinen, Platon zu unterstellen, dass er in seinem „Par-menides“ den Anfang des Denkens oder der Erkenntnis untersucht. Schließlich handelt es sich beim „Parmenides“ um einen der späteren Dialoge, und außerdem wird im Dialog selbst niemals expressis verbis von einem „Anfang des Denkens“ oder Ähnlichem gesprochen. Dem kann Folgendes entgegnet werden: gleich am Beginn des Dialogs werden beträchtliche Einwände gegen die Ideenlehre vorgebracht – Platon lässt Parmenides das Herzstück seiner philosophischen Doktrin kritisch beäugen, und Sokrates findet sich im Dialog in einer ungewohnt defensiven Rolle wieder: er würde Parmenides Kritik gerne etwas entgegen setzen, doch gelingt ihm dies kaum. Also muss, nachdem die Lehre von den Ideen ins Wanken gebracht wurde, ein neuer Ansatzpunkt her: „Was also willst du tun in Hinsicht der Philosophie?“ fragt Parmenides den Sokrates, nachdem sich dieser weitestgehend der Kritik des Parmenides an der Ideenlehre beugen hatte müssen. „Wohin willst du dich wenden, wenn du über diese Dinge [seiende Begriffe, die uns Erkenntnis vermitteln können, also die Ideen; Anm. d. Autors] keine Erkenntnis besitzt?“
Sokrates hat keine gute Antwort darauf. Und so bitten er und die übrigen Teilnehmer des Gesprächs den Parmenides, seine Frage selbst zu beantworten. Nach einigem Zögern lässt sich dieser dazu überreden, und sucht die Zustimmung seiner Zuhörer zu seinem Vorhaben: „ … wollt ihr, … dass ich von mir selbst anfange und von meiner Voraussetzung, indem ich das Eins selbst zugrunde lege, wenn es ist und wenn es nicht ist, was sich dann ergeben muss?“ Die anderen Teilnehmer bejahen dies. Aber ganz offensichtlich wird hier einen Neuanfang beschlossen, und zwar einer, der auf abweichenden philosophischen Ansätzen, und damit zunächst nicht auf der Ideenlehre beruht oder auf diese abzielt. Diese Indizien, dass einerseits von einem Anfang gesprochen wird im Dialog, und dass andererseits ein thematischer Neubeginn eingeläutet wird, sollen uns Rechtfertigung genug sein, um anhand des „Parmenides“ zu erörtern, wie Platon den Anfang des Denkens zu setzen gedenkt.
Wie bereits im obigen Zitat angeführt, beginnt Parmenides damit, „das Eins selbst“ zugrunde zu legen. Die Voraussetzung „Wenn Eins ist“ bildet deshalb den Parmenides Startpunkt, weil einerseits seine Lehren davon handeln (vgl. Parmenides, 128a: „Denn du in deinen Gedichten sagst, das Ganze sei Eins …“), und andererseits diese Hypothese inhaltlich passend zu sein scheint; Jede Entität ist ein „Eins“, und jede Entität „ist“. Das „Eins“ ist also der argumentationslogische Angriffspunkt des Parmenides, unter der Prämisse, dass es „ist“. Als Ansatz scheint „Wenn Eins ist“ also angemessen zu sein – größtmögliche Allgemeinheit wird hierdurch erreicht. Und da alle Erkenntnis letztlich aus einem Anfang entwickelbar sein soll, was eine natürliche Forderung an einen Beginn ist, ist diese Universalität auch vonnöten. Freilich ist es auch denkbar, „in der Mitte“ der Erkenntnis respektive des erkennbaren Bereiches der Welt anzufangen, oder sonstwo – aber warum nicht beim Anfang beginnen (sofern es einen gibt)?
Parmenides hätte seinen Anfang allerdings deutlicher formulieren können. Denn so harmlos, wie die schlichte Hypothese „Wenn Eins ist“ auch erscheinen mag, wird bald ersichtlich werden, welche Menge philosophischen Zündstoffes sie enthält. Der Grund hierfür ist, dass Parmenides seine Voraussetzung nämlich in einer äußerst strikten Art und Weise versteht: Wenn Eins ist, und nur als solches, isoliert und für sich allein genommen wird, d.h. allein der abstrakte Begriff „Eins“ betrachtet wird – was kann man daraus ableiten? Diese Verschärfung wollen wir wie folgt kenntlich machen: Was passiert, wenn Eins ist? Die Rigidität kennzeichnet die parmenideische Interpretation der Fragestellung. Als letzte Vorbemerkung darf schließlich wohl vermutet werden, dass Parmenides auch deshalb mit dem Begriff des „Eins“ seine Darstellungen beginnt, weil wohl diesem Begriff selbst eine gewisse Einheit und Abgeschlossenheit zukommen sollte, was seiner Herangehensweise förderlich wäre (was auf den ersten Blick durchaus vorstellbar erscheinen mag).
“Wenn Eins ist, dann …“
Der Anfang ist gemacht, und im Sinne des Parmenides richtig verstanden. Doch wohin führt er uns? Wenn nun Eins ist, lassen sich der Betrachtung des Parmenides gemäß einige Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das Eins
• ist weder ganz noch hat es Teile, • besitzt weder Anfang, Ende, Gestalt noch Ort, • hat weder Bestehen noch Wechsel, • ist weder einerlei, gleich, ähnlich, verschieden, ungleich oder unähnlich mit sich selbst oder Anderem, • weder älter, jünger, noch gleich alt wie es selbst oder Anderes, • ist nicht und kann auch nicht erkannt werden.
Exemplarisch wollen wir zwei dieser Folgerungen etwas näher betrachten: die erste und die letzte.
a) … ist es weder ganz noch hat Teile
Die Argumentation für die These, dass das Eins weder ganz sei noch Teile besitzt, verläuft nach dem folgenden Muster: Zuerst wird von Parmenides festgehalten, dass das Eins nicht Vieles sein könne. Dies wird von seinem Widerpart Sokrates ohne Zögern bestätigt. Aber Parmenides nächste Folge-rung, dass das Eins deshalb weder ganz sein könne, noch Teile besitzen dürfe, bedarf für den Sokrates einer Erklärung. Parmenides legt dar, dass „der Teil doch wohl Teil eines Ganzen“ sei und „das, dem kein Teil fehlte, ganz“ wäre. „In beiden Fällen also“, fährt Parmenides fort, würde „das Eins aus Teilen bestehen“, und „in beiden Fällen … wäre das Eins Vieles und nicht Eins“.
Der Leser könnte bei dieser Argumentationsweise stutzen: Nur weil etwas aus Teilen besteht, kann es nicht Eins sein? Könnte nicht, antipodisch zur Position des Parmenides behauptet werden: Gerade weil etwas aus Teilen besteht, und diese Teile in sich zu einem Ganzen vereint, ist es Eins? An diesem Punkt muss an die besondere Herangehensweise des Parmenides erinnert werden: Er versucht den Begriff des Eins isoliert zu betrachten, und ihn aus sich selbst heraus und unabhängig von anderen Begriffen zu bestimmen. Aus diesem Betrachtungswinkel heraus darf das Eins nichts mit irgendeinem anderen Begriff, und schon gar nicht mit seinem Antonym, dem Vielen zu schaffen haben: auch dann nicht, wenn das Viele dem Eins nur insofern anhaftet, als dass das Eins aus Teilen besteht. Nicht einmal der indirekte Weg, dass das Viele dem Eins durch sein Fehlen untergeschoben wird, dadurch nämlich, dass es ganz sei und ihm kein Teil fehlte, ist für Parmenides zulässig. Sogar die Negation des Vielen, vermittelt durch die das Fehlen des Vielen, namhaft der Teile, würde eine unzulässige Hilfestellung bei der Bestimmung des Eins durch einen anderen Begriffs bedeuten.
Allerdings bleibt ein ganz anderer Einwand bestehen: der Position des Parmenides kann eine gewisse Inkonsistenz nicht abgesprochen werden. Wie wir gerade ermittelt haben, will Parmenides die Vielheit nicht einmal im vermittelten und negativen Sinne zur Bestimmung des Eins heranziehen: nämlich dass dem Eins die Möglichkeit des Fehlen von Teilen abgesprochen werden muss: es darf nicht ganz sein. Damit spricht er aber auch noch etwas anderes aus: Dem Eins wird dann auch jede Möglichkeit zur negativen Bestimmung gegen das Viele genommen, anhand der Vielheit der Teile. Also steht der Weg nicht offen, das Eins via dem Begriff des Vielen durch Negation desselben zu bestimmen. Jedoch hat Parmenides eben dies getan, als er am Anfang der Argumentationskette ansetzte: „wenn Eins ist, so kann doch wohl das Eins nicht Vieles sein.“ Dieser Satz beinhaltet die Negation des Begriffes des Vielen in Bezug auf die Bestimmung des Begriff des Eins und ist somit nach Parmenides eigenem Anspruch nicht zulässig. Denn wenn selbst die indirekte Negation des Vielen in der Gestalt der notwendig fehlenden Teile eines Ganzen als argumentationslogische Brücke nicht zulässig ist, eben durch die Ablehnung der schieren Möglichkeit des Teile-Habens und damit des Vielheit-Habens des Eins, wird auch die direkte Möglichkeit des Vielheit-Habens, auch wenn sie nur in der Negation dessen besteht („das Eins ist nicht Vieles“), ausgeschlossen. Parmenides Argumentationskette schließt also ihre eigene Prämisse aus.
Wir wollen kurz zusammenfassen: nur unter der Voraussetzung, das der Begriff des Eins isoliert von anderen Begriffen bestimmt werden soll, ist die Schlusskette des Parmenides gültig. Die Folgerungen des Parmenides müssen also in dieser Lesart verstanden werden, sonst verliert das Argument seine Relevanz. Doch wie wir gesehen haben, ist eben diese Herangehensweise dafür verantwortlich, dass die Stützen des Arguments schwinden.
In letzter Konsequenz bedeutet unsere Überlegung Folgendes: Wenn Parmenides an seinem eigenen, strikten Ansatz gemessen wird, bleibt ihm für seine Beweisführungen nicht mehr viel übrig: Wenn kein anderer Begriff zur Bestimmung des Eins herangezogen werden darf, als es selbst, erübrigt sich jeder weitere Diskurs darüber. Denn in was sollte dieser bestehen als in der Verwendung von Begriffen? Als letzte Fragestellung bleibt also: Darf dieser Maßstab an die Schlussweisen des Parmenides angelegt werden? Es stehen auch andere Philosophen vor ähnlichen Schwierigkeiten, und haben sich diese auch zum Teil bewusst gemacht (ich bitte den Leser um Verzeihung, dass die Beispiele hier nur grob verkürzt und ohne Erklärung angegeben werden): Frege kann nicht, ohne sich, auch nach eigenem Bekenntnis, der Inkonsistenz schuldig zu machen, die Sprache in Konzepte und Namen aufteilen, wenn „das Konzept Pferd“ sowohl Konzept als auch Name ist. Wittgenstein weiß ebenfalls, dass es problematisch ist, die Leiter der Worte wegwerfen zu müssen, mit deren Hilfe er erst zu seinem Ziel hinaufgestiegen ist – und muss sich deshalb dem Schweigen überlassen. Und Parmenides kann nicht ohne Weiteres Begriffe als Ausgangspunkt einer Argumentationskette verwenden, nur um dann deren Verwendung in abgeänderter Gestalt als ungültig zu klassifizieren.
b) … ist es nicht und kann nicht erkannt werden
Die nächste Frage ist: ist sich Parmenides dieser Unstimmigkeit bewusst? Nicht vollständig, muss hierauf geantwortet werden. Ihm selbst fällt nicht direkt auf, dass seine Herangehensweise von Widersprüchen durchsetzt ist. Allerdings kommt er, nachdem er alle Bestimmungen des Eins durchgegangen ist d.h. alle möglichen Bestimmungen verneint hat, wie wir sie oben schon stichpunktartig angeführt haben, auf das Ergebnis (das wir an diesem Punkt einfach angeben wollen und die Argumente nicht en detail rekonstruieren): Das Eins ist nicht und kann auch nicht erkannt werden. Was letztlich nichts anderes bedeutet, als dass das Eins in jedem relevanten Wortsinne nicht existiert.
Was bedeutet „Das Eins ist nicht“?
Die Vorgehensweise des Parmenides, die der Hypothese „Wenn Eins ist …“ folgt, ist unserer Analyse gemäß nicht widerspruchsfrei und führt nach Parmenides eigener Einschätzung lediglich zu dem Ergebnis, dass das Eins auf keine Art und Weise ist. Man würde jedoch einen äußerst schwerwiegenden Fehler begehen, wenn man nun zusammenfassend konstatieren würde, dass das ganze Unternehmen sinn- und inhaltsleer gewesen wäre. Gewiss kommt Parmenides zu keinem befriedigendem Ergebnis, und ebenso sicher können Einwände gegen das Prinzip seiner Argumentationsweise vorgebracht werden. Doch auch ein negatives Resultat ist ein Resultat – und so fördert es eine wichtige, tiefer liegende Fragestellung zu Tage: Warum kann der Begriff des Eins nicht aus sich heraus bestimmt werden? Und weiter: wie kann ansonsten vorgegangen werden?
Die erste Frage können wir bereits unter Zuhilfenahme unserer Analyse zumindest im Ansatz beantworten: Das Eins kann nicht nur durch sich selbst bestimmt werden, weil wir in diesem Falle, wenn wir die Voraussetzung „durch sich selbst“ strikt befolgen, keine anderen Begriffe zur Hilfe nähmen dürften. Und wir müssen eingestehen, dass der elliptische Satz „Das Eins ist …“ es fordert, einen Begriff zur Bestimmung des Eins anzuführen, der nicht mit dem Eins identisch ist. Und diese Konklusion ist bereits der Lösungsansatz der zweiten Frage: Wir müssen andere Begriffe bemühen, um einen Begriff zu bestimmen.
Es besteht eine Analogie zu der anfangs angeführten Problematik (wenn auch die Ähnlichkeit vorerst noch etwas diffus ist): wir drehen uns im Kreis, wenn wir versuchen, einen Begriff aus sich selbst zu erklären. Die Bewegung im Geiste wird geschlossenen vorgenommen, isoliert von anderen Begrifflichkeiten – und offensichtlich genügt diese Art und Weise der Reflektion nicht, um einen einfachen Begriff wie das Eins hinreichend zu bestimmen.
Parmenides: „Wenn Eins ist …“
Parmenides kaum auf den Schluss, dass das Eins „nicht benannt, nicht erklärt, nicht vorgestellt, nicht erkannt, noch auch etwas, was es an sich hätte, wahrgenommen“ werden kann. Dies ist freilich kein befriedigendes Ergebnis. Also muss er seine Vorgehensweise modifizieren: Er fängt noch einmal von vorne an, allerdings mit einer abgeänderten begrifflichen Gewichtung: Statt auf der abgeschotteten Idee eines Eins zu beharren, betont er nun das Sein des Eins.
„Wenn Eins ist, dann …“
Mit dieser Verschiebung kommt er auf völlig andere Ergebnisse als zuvor: Das seiende Eins
• ist ganz und hat Teile, • impliziert die Begriffe von Zahl und Vielem, • hat Anfang, Ende, und Gestalt, • ist sowohl in sich selbst als auch in einem Anderen, • hat Bewegung und Ruhe, ist mit sich selbst sowohl identisch als auch von sich verschieden, ist verschieden von den Anderen [Dingen] und mit ihnen identisch, ist sich selbst und den Anderen [Dingen] ähnlich und unähnlich, berührt und berührt nicht die Anderen [Dinge] und sich selbst, ist gleich und ungleich an Größe und Zahl sowohl sich selbst als auch den Anderen [Dingen], ist und ist nicht jünger und älter als es selbst und die Anderen [Dinge], wird und wird nicht älter als es selbst und die Anderen [Dinge], • kann erkannt werden.
Wie sofort zu sehen ist, sind alle diese Resultate konträr zu den obigen, wo das Eins für sich allein betrachtet wurde. Wie kommt es zu solch einer Wandlung? Und wo wird diese in den Darstellungen des Parmenides ersichtlich? Um diese Fragen zu beantworten, wollen wir eine der Schlussketten herausgreifen, und zwar gleich die erste.
Parmenides beginnt sein Argument mit dem Satz: „Wenn Eins ist, ist es dann wohl möglich, daß es zwar ist, aber kein Sein an sich hat?“ Dies wird von Sokrates verneint. Damit muss aber eine zweite Begrifflichkeit auf den Plan treten, nämlich das „Sein des Eins, und zwar als nicht einerlei seiend mit dem Eins.“ Das Sein wird also als ein genuin anderer Begriff als das Eins gesetzt, „denn sonst wäre jenes [das Sein, Anm. d. Autors] nicht dessen Sein, sondern es, das Eins hätte nicht das Sein an sich“ . Diese Passage macht deutlich, wie Parmenides seine Vorgehensweise modifiziert hat: Wo früher das „ist“ bei „Wenn Eins ist“ stillschweigend mit an Bord war, und zwar mehr oder weniger nur als grammatikalische Notwendigkeit für die Satzform von „Wenn Eins ist“ und nicht als begriffli-ches Substrat, das philosophische Verwicklungen mit sich bringt, wird es jetzt als eigenständige, unabhängige Begrifflichkeit verstanden, die in Synthese mit der des „Eins“ das nun betrachtete „seiende Eins“ ergibt.
Über diese argumentative Brücke erschließt sich Parmenides nun den ganzen Katalog der oben angeführten Wesenszüge des seienden Eins, angefangen damit, dass das seiende Eins Teile hat und, kontrapositorisch zum obigen Eins, damit Vieles ist: weil ja, wie eben dargestellt, das Sein und das Eins zum seienden Eins synthetisieren, dabei aber nicht miteinander identisch sind, kann man davon sprechen, dass in einer gewissen Art und Weise das Sein und das Eins Teile des seienden Eins sind.
Aus Platzgründen kann an dieser Stelle leider keine Analyse aller der Schritte erfolgen, die Parmeni-des auf die obige Palette von Eigenschaften des seienden Eins schließen lassen. Allerdings sollte die Grundidee deutlich geworden sein, wie der neu hinzugefügte begriffliche Partner des Eins, namentlich das Sein, die argumentationslogische Lage verändert. Weshalb sich der schlichte Betonungswechsel von „Wenn Eins ist“ zu „Wenn Eins ist“ so drastisch niederschlägt, dass dem seienden Eins nun völlig gegensätzliche Bestimmungen zukommen – das wollen wir jetzt näher betrachten.
„Wenn Eins ist, dann …“ ist alles
Nach obiger Auflistung werden dem seienden Eins nun sehr viele Charakteristika zugesprochen. Näher betrachtet besitzt es nun alle die Eigenschaften, die zuvor dem Eins abgesprochen wurden. Und da zuvor dem Eins kein einziger Wesenszug zukam, und zwar notwendigerweise, liegt der Umkehrschluss nahe, dass dem seienden Eins nun vielleicht sogar alle angetragen werden müssen. Tatsächlich kommt Parmenides zu diesem Ergebnis: „ … wenn Eins ist, ist das Eins alles und auch wieder nicht einmal Eins, sowohl für sich selbst als für die Anderen gleichermaßen.“
Allerdings scheint die Allgemeinheit des seienden Eins etwas über das Ziel hinaus geschossen zu sein: Parmenides muss sich, wenn er dem Eins alle möglichen Attribute zuweist, im selben Atemzug eingestehen, dass ihn seine eigene Beweisführung wiederum in Schwierigkeiten bringt. Denn die Bestimmungsarten des seienden Eins werden nun zu einem solchem Maße allgemein, dass in diese Menge aller Eigenschaften auch die sich gegenseitig widersprechenden fallen und dem seienden Eins beigelegt werden, namentlich alle Bestimmungen, die in obiger Liste mit einem Pfeil als Aufzählungszeichen hervorgehoben sind. Das seiende Eins wird also mit Kontradiktionen belegt. Mit dieser Beobachtung gehen unmittelbar zwei Fragen einher: Warum verhält es sich so und was bedeutet dies für das Resultat der Bestimmung des seienden Eins?
Leider kann hier keine exakte Rekonstruktion aller Argumentationsketten angeführt werden, die auf die kontradiktorischen Konnotationen des Begriffs des seienden Eins führen. Vielmehr soll nur eine Interpretation der Schlussfolgerungen des Parmenides angeboten werden, die dieses Resultat plausibel macht: Am Anfang seiner Unternehmung beleuchtete Parmenides das Eins, insofern es ist. Nach einem unbefriedigendem Resultat musste er aber, wie oben bereits erklärt, das methodische Licht seines Vorgehens vom Begriff des Eins abziehen und auf den des Seins richten: er betrachtet im Grunde nun das Sein, insofern es Eins ist. Nun ist es aber so, dass überhaupt alles, was in irgendeiner Form existiert, ein seiendes Eins ist. Dieser Schluss liegt nahe genug: alles, was in irgendeiner Form existieren kann, dem muss ein Sein zugesprochen werden, und auch ein Eins-Sein: denn sonst wäre es nicht als eine einzelne Entität erkennbar. Alles, was sowohl materiell oder nur in Gedanken ist, dem muss das Sein und das Eins zugesprochen werden, und sollte es auch nur die Notwendigkeit der Satzform sein, die dieses fordert: Alles, was in einem vielleicht auch noch so schwachen Sinne ist, kann als Subjekt eines Satzes fungieren, und bekommt damit a priori die Attribute des Seins und des Eins-Seins zugesprochen, ist also seiendes Eins. Hierfür ist lediglich eine wie auch immer geartete Seinsart der betrachteten Entität erforderlich, weil es ja in jedem Falle gedacht oder in einem Satz erwähnt wird (obwohl es vielleicht nicht wirklich „ist“), sowie eine Trennbarkeit seiner von seiner Umwelt und Umgebung: sonst könnte es nicht als Eins allein stehen und deshalb nicht als solches erkennbar, d.h.: wir könnten es weder denken noch darüber sprechen. Was wiederum bedeutet, dass es, für alle in irgendeiner Form für den Menschen relevanten Zwecke und Verwendungsarten, nicht existieren würde.
Wenn aber der Begriff des seiende Eins dermaßen allgemein ist, das es alles a priori mögliche um-spannt, ist es nicht verwunderlich, dass ihm dem seienden Eins, wenn es einer begrifflichen Analyse unterzogen wird, die Möglichkeit zugesprochen werden muss, alle denkbaren Eigenschaften zu besitzen. Und unter allen denkbaren Eigenschaften finden sich dann auch die gegenseitig widersprüchlichen .
Ein Punkt von hoher Wichtigkeit muss jedoch noch hinreichend deutlich gemacht werden: Die Enti-tät, welche auch immer auf welche Weise auch immer betrachtet wird, darf den Seinsbegriff des seienden Eins auch nur im schwächest denkbaren Sinn besitzen, sie wird trotzdem immer noch unter diesen fallen. Man betrachte das Beispiel des „hölzernen Eisens“. Dass dieser Entität der Begriff des Eins in gewisser Weise zukommt, ist klar ersichtlich. Gerade haben wir es mit einem bestimmten Artikel im Singular angeführt, und als einen Baustein eines Satzes verwendet. Außerdem kommt ihm auch ein Sein in gewisser Art und Weise zu: beispielsweise dadurch, dass wir es gerade dazu verwenden, um eine Aussage zu machen. Natürlich existiert in der Realität kein hölzernes Eisen, weil aber der Begriff, also die Kombination von zwei Worten, als aussagelogisches Satzelement existiert, muss diesem, wenn auch auf sehr schwache Weise, eine Art von Sein zugestanden werden, d.h. es ist zumindest eine gedankliche Entität. Ansonsten wäre das Ergebnis des Parmenides völlig inhaltsleer und die ganze Untersuchung vergebens gewesen. Gewiss ist das Resultat paradox – aber nach der Eigenart einer Paradoxie, über einen scheinbaren Widerspruch auf eine höhere Wahrheit hinzuweisen, wird es uns später in unsere Analyse noch einiges weiter helfen.
Natürlich benutzt das gerade angeführte Argument, ebenso wie die vorangegangen Analyse, implizit eine Grundannahme: dass das rein begriffliche Sein von etwas schon eine Art des Seins ist. Die Position, die dahinter steht, darf allerdings nicht mit einem wirklichkeitsblinden Idealismus der Ideenwelt verwechselt werden. Es wird nur vorausgesetzt, dass das Sein der Entität einen Bezug auf den Menschen erhält. Etwas ist also, insofern wir es auf irgendeine Art und Weise, mit den Sinnen oder dem Verstand, erkennen können. Wir beleuchten also das Sein einer Entität nur so, wie es sich uns darstellt, d.h. unter den Bedingungen, wie es gemäß der menschlichen Art zu erfahren und zu erkennen (auch die rein gedankliche) überhaupt möglich ist. Wer diese Annahme nicht voraussetzen kann oder will, für den ist die Lektüre des Parmenides und damit auch unsere gegenwärtige Untersuchung freilich von vornherein zweck- bzw. sinnlos.
Allerdings wird hierdurch die letztlich auftretende Problematik noch nicht gelöst. Wir sind noch eine Antwort auf die zweite oben gestellte Frage schuldig, nämlich was die hoch-allgemeine und kontra-diktorische Bestimmung des seienden Eins nun für Parmenides und für unsere Betrachtung bedeutet. Wie Nietzsche einmal bemerkte, dass das Sein der allgemeinste und deshalb auch leerste Begriff sei, stehen wir mit Parmenides nun vor dem Problem, dass zum zweiten mal der Begriff des Eins in den Händen zerrinnen zu scheint: Beim ersten Versuch blieben gar keine Möglichkeiten zur Bestimmung des Eins über, und beim zweiten zu viele und, a fortiori, nicht zueinander passende.
Der Verdacht, den wir anfangs geäußert haben, erhält hier wieder eine näher bestimmte Ausprä-gung: Der Anfang des Denkens, mit dem Begriff des Eins gesetzt, scheint sich einerseits nicht aus sich selbst zu erklären zu lassen, und schlimmer noch: die Herangehensweise selbst ist schon inkonsistent. Wenn wir andererseits einen möglichst allgemeinen Begriff an den Anfang setzen: Wie soll dann weiter gedacht werden, wo doch bereits alles in den Anfangsbegriff gesetzt wurde? Oder anders formuliert: Wie soll eine konkrete Bestimmung von etwas angegeben werden, das alle möglichen Bestimmungen schon in sich schließt?
Mit diesen Fragestellungen wollen wir unsere Untersuchung von Platons Parmenides beenden. Denn wie Parmenides letztlich mit den genannten Schwierigkeiten umzugehen vermag oder sie zu lösen imstande ist, ist nicht Gegenstand unserer Untersuchung.
[Als letzte Randbemerkung soll eine ganz andere Auffälligkeit noch bemerkt werden: Bei beiden Herangehensweisen des Parmenides, sowohl bei „Wenn Eins ist …“ als auch bei „Wenn Eins ist …“ ist zu bemerken, dass gar nicht so sehr der Begriff des Eins im Vordergrund steht. Letztendlich ist die fundamentale Idee, aus der die philosophische Substanz des Dialogs geschöpft wird, die des Seins. Bei „Wenn Eins ist …“ versucht Parmenides ledi ] eher als Vergleichsthema setzen. Sein = Eins (Hegel bzw. Platon??)
Nach dieser letzten Bemerkung zu Parmenides wollen wir uns nun dem Anfang des Denkens bei Hegel widmen.
Hegel: das Sein
Während bei Parmenides die Schwierigkeit eines Anfangs des Denkens erst nach der eigentlichen Untersuchung deutlich wird, ist sich Hegel ihrer von vornherein bewusst. Dass diese Erkenntnis ihn von anderen, früheren philosophischen Wegen abführt, lässt gleich der erste Satz des ersten Buches der Wissenschaft der Logik erahnen: Denn „In neueren Zeiten erst ist das Bewußtsein entstanden, daß es eine Schwierigkeit sei, einen Anfang in der Philosophie zu finden“ . Anstatt jedoch danach ein konzeptionelles Bild eines Anfangs zu entwickeln, erklärt er zunächst, was der Anfang nicht ist: „er muß entweder ein Vermitteltes oder Unmittelbares sein, und es ist leicht zu zeigen, daß er weder das eine noch das andere sein könne“ . Allerdings ist dies kein rein negatives Eingeständnis eines Nicht-Wissens um den Anfang – er umreisst hier lediglich die für ihn grundlegende Problematik; eben dass der Anfang weder unmittelbar gegeben noch vermittelt durch etwas anderes sein könne. Diese Beobachtung erschließt also den Kern der Fragestellungen für die nachfolgenden Betrachtungen, und bildet nicht deren verfrühte Aufgabe.
Hegels Anfang: Unmittelbarkeit und Vermitteltheit
Dass der Anfang des Denkens nicht vermittelt, also von anderswoher initiiert sein kann, ist klar: denn dann wäre jener nicht der Anfang, und der wahre Anfang wäre im Ursprung dieser Vermittlung zu suchen. Aber warum sollte er nicht unmittelbar gegeben sein können? Hegel führt einige Beispiele an, woher ein unmittelbarer Anfang gezogen werden mag: einerseits, wie anfangs schon erwähnt, einige Exempel aus der Philosophiegeschichte („das Wasser, das Eine, Nus, Idee – Substanz, Monade usf.“ ), andererseits führt er einige Grundlegungen für einen Anfang an, die er seinen Zeitgenossen in den Mund legt: jenen, „ die wie aus der Pistole geschossen aus ihrer inneren Offenbarung, aus Glauben, intellektueller Anschauung usw. anfangen“ . An anderer Stelle, in der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, gibt Hegel eine etwas genauere Auskunft über seine Vorstellung über die Natur eines unmittelbaren Anfangs: „Mit dem, was hier Glauben und unmittelbares Wissen heißt, ist [es] übrigens ganz dasselbe, was sonst Eingebung, Offenbarung des Herzens, ein von Natur in den Menschen eingepflanzter Inhalt, ferner insbesondere auch gesunder Menschenverstand, common sense, Gemeinsinn, genannt worden ist. Alle diese Formen machen auf die gleiche Weise die Unmittelbarkeit, wie sich ein Inhalt im Bewußtsein findet, eine Tatsache in diesem ist, zum Prinzip.“
Warum kann sich für Hegel keiner von diesen unmittelbaren Anfängen als Beginn des Denkens qualifizieren? Wenig später gibt er die Antwort selbst: weil „das unmittelbare Wissen sich eine ausschließende Stellung gibt“ . Unmittelbar Gegebenes ist als solches in seinem Sein und Wirken für unser Denken abgeschlossen: es braucht keiner irgendwie gearteten Rechtfertigung, weil es unmittelbar ist. Dadurch erhält der Anfang aber eine zirkuläre Seinsart: durch seine Unmittelbarkeit entnimmt er sich auch dem Denken, insofern auf ihn reflektiert werden soll. Sein ontologischer Status ist durch die Unmittelbarkeit schon derart gefestigt (weil er ja unmittelbar sein soll, also von nichts anderem vermittelt wird, und deshalb von nichts abhängt), dass er keinerlei weiterer Analyse bedarf und, a fortiori, nicht bedürfen kann: weil es unmittelbar, und das heißt geschlossen, frei aller Bindungen ist. Unmittelbarkeit bedeutet für Hegel also notwendig fehlende Interdependenz: Egal, mit welchem Begriff oder mit welchen Begriffen der Anfang des Denkens gesetzt wird (und mit irgendwelchen Worten, also Begriffen, muss der Anfang des Denkens ja gesetzt werden) – wenn er oder sie keine wie auch immer geartete Bindung an andere Begriffe haben, erübrigt sich auch jedwedes weitere Nachdenken darüber. Und wenn der Anfang keine Progression in irgendeiner Richtung impliziert, ist er kein Anfang. Hegel selbst führt diese Problematik in vielen Formulierungen vor Augen, in seiner äußerst abstrakten Art und Weise. Einmal aber benutzt er ein prominentes Beispiel: „Aber auch in der Weise der Unmittelbarkeit ist jener Satz … von deren Urheber ausgesprochen worden: Cogito, ergo sum. Man muß von der Natur des Schlusses etwa nicht viel mehr wissen, als daß in einem Schlusse „ergo“ vorkomme, um jenen Satz für einen Schluß anzusehen; wo wäre der medius terminus [der mittlere, vermittelnde Begriff; Anm. d. Autors]? Und ein solcher gehört doch wohl wesentlicher zum Schlusse als das Wort „ergo“. Will man aber, um den Namen zu rechtfertigen, jene Verbindung bei Descartes einen unmittelbaren Schluß nennen, so heißt diese überflüssige Form nichts anderes als eine durch nichts vermittelte Verknüpfung unterschiedener Bestimmungen. Dann aber ist die Verknüpfung des Seins mit unseren Vorstellungen, welche der Satz des unmittelbaren Wissens ausdrückt, nicht mehr und nicht weniger ein Schluß.“
Das philosophische Denken vollzieht sich in Schlussketten, und ein unmittelbarer Anfang würde kein vermittelndes Moment enthalten, das Schlüsse erst möglich macht. Letztlich ist also alles Denken in irgendeiner Form vermittelt, und damit nicht unmittelbar.
Hegel betrachtet hier das Denken, respektive einen Spezialfall des Denkens, namentlich dessen Anfang, in einer stark phänomenologisch geprägten Art und Weise: wenn ein Begriff, eine Vorstellung oder Anschauung unmittelbar gegeben ist, bildet sie eo ipso einen geschlossenen Wirkkreis innerhalb des Denkens, ein isoliertes Vorkommnis im Bewusstsein, und enthält keinerlei Fingerzeig auf andere Begriffe, Vorstellungen oder Anschauungen. Einem unmittelbaren Anfang fehlt schlicht die Triebfeder, die einen weiterführenden Gedankengang auslösen könnte: weil etwas Unmittelbares, Geschlossenes nicht aus sich hinaus führen kann.
Damit sollten die Grundzüge der Problematik hinreichend deutlich geworden sein: Der Anfang des Denkens kann nicht vermittelt sein, weil er sonst nicht der Anfang wäre. Der Anfang des Denkens kann aber ebenso wenig unmittelbar sein – weil dann anhand von ihm nicht mehr weiter gedacht werden könnte und er damit wiederum kein Anfang des Denkens ist.
Hegels erste Kategorie: das Sein
Trotz der genannten Schwierigkeiten beginnt Hegel freilich irgendwann sein Denken. Mit welcher Rechtfertigung er dieses tut, also wie er die Problematik des Anfangs behandelt, ob er sie lösen kann oder schlichtweg umgeht, kann hier aus Platzgründen leider nicht näher untersucht werden. Wir wollen lediglich die Tatsache festhalten, dass er nach einer intensiven Auseinandersetzung mit den genannten Schwierigkeiten letztlich einen Anfang setzt. Und für Hegel, dessen Gesamtwerk man vielleicht grob als eine kategoriale Durchmessung der Welt bezeichnen könnte, dessen Ziel die vollständige Phänomenologie des Auftretens von Wahrheit und Wissen ist, zu welchen der menschliche Geist imstande ist, steht ein Begriff am Anfang: das Sein. Dass jedoch dieser Anfang nicht unproblematisch ist, wollen wir jetzt erweisen.
„Sein, reines Sein, – ohne alle weitere Bestimmung“ ; das ist Hegels erster begrifflicher Angriffspunkt. Diesen näher zu erläutern ist überflüssig, denn Hegel tut dies selbst zur Genüge: „In seiner unbestimmten Unmittelbarkeit ist es nur sich selbst gleich und auch nicht ungleich gegen Anderes, hat keine Verschiedenheit innerhalb seiner noch nach außen. Durch irgendeine Bestimmung oder Inhalt, der in ihm unterschieden oder wodurch es als unterschieden von einem Anderen gesetzt würde, würde es nicht in seiner Reinheit festgehalten. Es ist die reine Unbestimmtheit und Leere.“ Das Sein ist also unbestimmt, gänzlich frei von Inhalten und deshalb inhaltslos und leer. Die Analogie zu Parmenides Eins drängt sich auf: auch dort erwies sich der erste Begriff, das abstrakte, von allem isolierte Eins letztlich als inhalts- und bestimmungslos. Es muss aber erinnert werden, dass selbst diese Bestimmung nicht ganz unproblematisch war: Wie wir gesehen haben, war Parmenides Analyse von Anfang an mit einem Widerspruch durchsetzt. Denn Parmenides wollte das Eins isoliert von allem Anderen nehmen – womit er sich selbst letztlich von seiner eigenen Untersuchung isolierte, sich quasi selbst den argumentationslogischen Boden unter den Füßen wegzog. Und Hegel hat mit exakt derselben Problematik zu kämpfen: Denn obwohl er sich selbst zur Genüge mit dem Problem eines unmittelbaren Anfangs aufgehalten hatte, kann er doch nicht ganz dessen philosophischen Gräben ausweichen. Im Gegenteil, die Schwierigkeit tritt bei Hegel nur noch deutlicher und schärfer zu Tage: „Sein, reines Sein, – ohne alle weitere Bestimmung“ – so begann er. Und genau nach dieser Aussage dürfte er, wenn er sich eine konsistente Methodik des Voranschreitens bewahren will, eigentlich gar nichts mehr weiter anführen. „Ohne alle weitere Bestimmung“, so setzt er das Sein, und schreitet dann fort, es zu erläutern – und es damit näher zu bestimmen. Jedes Wort, das er danach anführt, trägt zur näheren Betrachtung des Seins bei, das doch, seiner eigenen Aussage gemäß, ohne Bestimmung bleiben sollte. Im Grunde dürfte er nicht einmal, logisch betrachtet, den Halbsatz „ohne alle weitere Bestimmung“ anführen – denn damit legt er schon eine Bestimmung des Seins fest, nämlich ohne Bestimmung zu sein.
Dies nicht die einzige Stelle (wenn auch vielleicht die markanteste), an der die Inkonsistenz in Hegels Vorgehen deutlich wird. Beispielsweise spricht er wenig später vom Sein als das „reine, leere Anschauen“ und das „leere Denken“ . Aber der Terminus „leeres Denken“ ist so widersprüchlich wie das schon vorher bemühte „hölzerne Eisen“; ebenso verhält es sich mit einem „leeren Anschauen“.
Insgesamt muss sich Hegel, genau wie Platon, Inkonsistenz in der Herangehensweise anschreiben lassen. Hegels Anfang versucht ein reines Sein, ohne allen weiteren Inhalt zu setzen – und dies ist, wenn der Anfang nicht nur einfach dogmatisch gesetzt, sondern auch gerechtfertigt und erklärt werden soll, logisch unmöglich, ohne die Konsistenz im Vorgehen zu verlieren. Dass Hegel eben diese Inkonsistenz benötigt, um sich überhaupt zu seinem zweiten Begriff, dem des Nichts, fortbewegen zu können, ist ebenso eine Tatsache wie an dieser Stelle zweitrangig. Die bloße zweckmäßige Notwendigkeit, einen Anfang nicht anders setzten zu können als in sich selbst widersprechender Weise, wiegelt das Faktum der Inkonsistenz in keiner Weise ab. Dass das wesentliche Moment der Hegelschen Philosophie, die Negation, ebenfalls mit der Kraft des Widerspruchs arbeitet, ist hier zunächst nicht ausschlaggebend: es soll lediglich festgehalten werden, dass Hegel im Grunde nicht konsistent über seine eigenen Anfang sprechen kann. Ob er es auf eine kohärente Weise tun kann (wobei das Wort „kohärent“ hier „auf irgendeine Art und Weise bedeutungsvoll“ bedeuten soll), werden wir später noch sehen .
Der Anfang des Denkens bei Platon und Hegel
Gemeinsamkeiten, Unterschiede und die Frage: welcher Anfang ist der ursprünglichere?
Nachdem wir nun die Grundzüge der Problematiken festgehalten haben, die sowohl Platon als auch Hegel bei ihrem jeweiligen Anfang des Denkens beschäftigen, wollen wir nun untersuchen, inwieweit sie echte Gemeinsamkeiten besitzen. Es ist nämlich zu hoffen, dass mittels eines Vergleichs eine noch klarere Formulierung des Problems aus Platons respektive Hegels philosophischer Vorarbeit gewonnen werden kann. Die zentrale Gemeinsamkeit der beiden Ansätze ist jedoch bereits heraus gestellt worden: die Behaftung mit Widersprüchen der jeweiligen Anfänge im Denken. Deshalb wollen wir uns für den Moment, ausgehend von der Betrachtung der offensichtlichsten Unterschiede, über eben diesen Umweg den Bereich der philosophischen Gemeinsamkeiten von Platons und Hegels Anfängen abstecken.
Die beiden von Parmenides vorgelegten Ansätze operieren mit dem Begriff des Eins, während Hegels Anfang sich auf das Seins konzentriert. Insbesondere Parmenides erster Ansatz kapriziert sich auf die Idee des Eins und führt das „ist“ im Satz „Wenn Eins ist“ als bloße grammatikalische Notwendigkeit, als Kopula, mit sich. Mehr noch, dem Eins wird explizit jede Anbindung an das Sein abgesprochen, und zwar in der schon diskutierten letzten Schlussfolgerung: „Also hat das Eins auf keine Art ein Sein? – Nein, wie es aussieht. – Auf keine Weise ist also das Eins.“ Deshalb könnte Parmenides These, ohne damit eine begriffliche Beschränkung zu erfahren, auch in einen elliptischen Halbsatz wie etwa „Wenn Eins, dann …“ umgeformt werden. Auf eine bestimmte Art und Weise könnte man sogar sagen, dass die Formulierung des Problems mit Hilfe des Begriffes des Eins die grundlegendere ist, grundlegender als Hegels unbestimmtes Sein, und zwar aus folgendem Grund: auch Parmenides Denkweise entbehrt nicht einer gewissen phänomenologische Komponente – denn schließlich strebt er nicht danach, ein absolutes Eins in der materiellen Welt nachzuweisen bzw. dieses zu bestimmen, sondern er betrachtet die Wirkkreise der Idee des Eins, insofern es im Denken auftritt und versucht, es als eigenständige Einheit innerhalb eines begrifflichen, denkensbezogenen Vorkommnis, als in sich geschlossener Bewusstseinsinhalt zu fassen. Und da der Begriff des Eins schon durch ein erstes, naives Verständnis, und durch seine Nähe zu Begriffen wie Einzelheit und Eins-Sein, also quasi durch sich selbst auf eine Einheit, und damit Abgeschlossenheit hinweist, schließt er die Problematik, die sich daraufhin zeigt, wenn ein Begriff als getrennt von allen anderen bestimmt werden soll, schon in sich. Hegel muss hingegen, mit dem Begriff des reinen Seins, Umwege beschreiten: Dem Begriff des Seins ist nicht durch sich selbst bereits eine absolute Unbestimmbarkeit gegeben, und bietet von sich aus auch keinen offensichtlichen Grund für diese Annahme. Diese muss ihm erst analytisch abgerungen werden, und deshalb tritt auch die Widersprüchlichkeit des Ansatzes, wie oben erwähnt, schärfer zu Tage – weil er ihm in möglichst deutlichen, expliziten Worten, und nicht ohne eine gewisse Anstrengung die Abstraktion von allen anderen Begriffen („ohne alle weitere Bestimmung“ – wobei diese „Bestimmungslosigkeit von langer Hand vorbereitet und auch noch näher erläutert wird) injizieren muss, während das Eins diese schon selbst, oder zumindest den Fingerzeig darauf, in sich trägt. Dem Parmenides hingegen Inkonsistenz in Bezug auf die eigene Herangehensweise nachzuweisen, fällt genau deshalb schwerer; weil er den Leser quasi mit der Idee des Eins (und der damit konnotierten Einheit) schon die Trennung des Eins von allen anderen Begriffen schmackhaft macht. So kann auch der Ansatz mit dem Eins aus demselben Grund als der grundlegendere angesehen werden: denn er schließt die Problematik von Anfang an in sich. Seine Phänomenologie (was nichts anderes bedeuten soll als die Bedingungen und Konsequenzen seines Auftretens im Bewusstsein, also seine begrifflichen Interdependenzen und Konnotationen, sowie seine Wirkung als bedeutungstragendes Wort) als Begriff zeigt sich in Ansätzen durch ihn selbst.
Dieser Betrachtung muss jedoch folgender Punkt entgegengesetzt werden: Im Gegensatz zu Platon macht Hegel die Schwierigkeit von Anfang an deutlich. Was bei Platon als Resultate ans Ende gesetzt wird, stellt Hegel als Grundproblematik vorne an. Er ist sich der Hindernisse, die vor ihm stehen, hochbewusst – und im Zuge dieser Beobachtung man kann die Ansicht vertreten, dass Hegel in seinen Ausführungen beide Problematiken, die sich dem Parmenides stellen (nämlich das Abstraktions- und das Allgemeinheits-Problem), in einer philosophischen Behandlungsmethodik vereint. Diese Tatsache würde wiederum die Hegelsche Artikulation des Problems des Anfangs zur grundlegenderen küren. Für die Begründung dieser Ansicht wollen wir hier eine neue Nomenklatur einführen: Parmenides ersten Ansatz (Wenn Eins ist), in dem das Eins unbestimmt bleibt und nicht ist, weil es für sich allein genommen wird, wollen wir als das „Problem des Bezugs zwischen Abstraktion und Konkretisierung“ (abgekürzt als „Abstraktions-Problem“) bezeichnen. Seinen zweiten Beginn (Wenn Eins ist), in dem das Eins so allgemein wird, dass nicht mehr befriedigend gefasst werden kann, wollen wir das „Problem des Bezugs zwischen Allgemeinheit und Besonderheit“ (abgekürzt als „Allgemeinheits-Problem“) nennen .
Beispielsweise reißt schon ein einläutender, kurzer Paragraph aus der Enzyklopädie der Wissenschaften beide Problematiken an, die auch den Parmenides beschäftigen: „In der kritischen Philosophie wird das Denken so aufgefaßt, daß es subjektiv und dessen letzte, unüberwindliche Bestimmung die abstrakte Allgemeinheit, die formelle Identität sei; das Denken wird so der Wahrheit als in sich konkreter Allgemeinheit entgegengesetzt. In dieser höchsten Bestimmung des Denkens, welche die Vernunft sei, kommen die Kategorien nicht in Betracht.“ Verdichtet man den Gehalt dieser Passage auf einen Satz, so sagt sie aus, dass ein verabsolutiert-verallgemeinerter Bewusstseinsinhalt den Begriffen und damit dem Weiterdenken enthoben ist. Die „abstrakte Allgemeinheit, die formelle Identität“, von der hier gesprochen wird, beherbergt in seinem begrifflichen Umfang das Eins des Parmenides, das sich wie eben diese Allgemeinheit oder Identität außerhalb der Begriffssphäre stellte. Aber genauso fasst dieser Abschnitt aus Hegels Feder die Probleme in sich, die beim seienden Eins, also dem zweiten Anfang des Parmenides auftreten: Denn „Der entgegengesetzte Standpunkt ist, das Denken als Tätigkeit nur des Besonderen aufzufassen und es auf diese Weise gleichfalls für unfähig zu erklären, Wahrheit zu fassen.“ Das seiende Eins sondert sich wirklich ab, aber leider in alle möglichen Bereiche hinein, so dass es nicht mehr zu fassen ist, so dass jede Besonderheit aus ihm verschwindet und nur leere Allgemeinheit zurückbleibt. Es ist an dieser Stelle wichtig, dass deutlich zwischen den Prädikaten von abstrakt und allgemein unterschieden wird: Das seiende Eins ist nicht abstrakt, sondern nur allgemein: weil es sich zu jeder möglichen Bestimmungen „besondert“, schlägt diese Besonderung um und wird auf unbestimmte Art und Weise allgemein. Ihm fehlt das Moment der Abstraktion: wenn es nämlich alle möglichen Bestimmungen in sich einschließen muss, kann nicht mehr das eine Substrat daraus abstrahiert werden, dass eben dieses seiende Eins wäre. Das Eins hingegen ist nur abstrakt, und nicht allgemein: es umfasst absolut keine Bestimmung. Ihm fehlt das Moment der Besonderung in einzelne Inhalte gänzlich.
Der eben untermauerte Standpunkt, dass Hegel beide Grundproblematiken, nämlich die des Eins und des seienden Eins in seinen Ausführungen vermischt, mag noch nicht vollständig deutlich geworden sein, genauer gesagt könnte es so erscheinen, als wollten wir Hegel etwas in den Mund legen, dass er so nie vertreten hat. Wenn wir aber eine wiederholte Betrachtung von Hegels erstem Begriff, dem des reinen Seins anschließen, wird der Sachverhalt klarer: Als Sein ist das reine Sein allgemein: jedes Etwas, das in der materiellen Welt existiert hat sein Sein, und auch jedes auch noch so abstruse oder unmögliche Gedankending besitzt ein Sein in einer gewissen Art und Weise, wenn auch nur für das Denken als Bewusstseinsinhalt. Deshalb bezieht sich der Begriff des Seins auf wirklich alles und ist deshalb allgemein. Weil Hegel ihn aber mit dem Attribut „rein“ versieht, gibt er ihm auch Abstraktion: das reine, von allen Bestimmungen gelöste Sein, wird durch und in nichts konkretisiert und bleibt deshalb ein Abstraktum. Damit erfasst Hegel in seinem Ansatz des Seins beide Grundproblematiken, nämlich das Abstraktions- sowie das Allgemeinheits-Problem. In gewisser Weise muss also dem obigen Standpunkt widersprochen werden: Hegels Ansatz ist der grundlegendere, und nicht einer der des Parmenides, weil er die philosophische Masse von beiden in sich fasst. Mit dieser inhaltlichen Umschließung holt er sich aber auch notwendigerweise die Schwierigkeiten, die mit diesen Problemen einher gehen, mit an Bord: Einerseits ist der Ansatz des Seins deshalb widersprüchlich, weil er rein sein soll, d.h. ohne weitere Bestimmungen. Diese Inkonsistenz, als notwendiges Korrelat der Betrachtungsweise, ist, wie oben ausgeführt, sowohl bei Parmenides als auch bei Hegel zu finden. Andererseits muss Hegel notwendigerweise auch der Fortschritt vom Allgemeinen ins Besondere schwer fallen, weil sein Begriff des Seins eben jene absolute Allgemeinheit fordert. Diese Schwierigkeit fand sich ebenfalls bei Platon (wo das seiende Eins so allgemein wird, dass es nichts mehr ist), und in abgeänderter Form auch bei Hegel (wo die Unmittelbarkeit des Anfangs die Vermittlung zum weiteren Denken ausschließt). Sowohl Abstraktions- als auch Allgemeinheits-Problem fallen also in den Einzugsbereich des Begriffes des reinen Seins, weil der Begriff des Seins das Potential zur Abstraktion wie zur Allgemeinheit besitzt, wohingegen Parmenides das Sein mit Hilfe des Begriffes des Eins in diese philosophischen Pole auseinander dividiert. Das Sein ist also wirklich, um noch einmal mit Nietzsche zu sprechen, der sowohl allgemeinste als auch leerste Begriff.
Auf der Spur eines philosophisch-logischen Grundproblems
Das letzte Kapitel unserer Untersuchung wollen wir nicht darauf verwenden, Lösungsvorschläge für Problematiken zu diskutieren, die die verschiedenen dargestellten Anfänge des Denkens für uns und für ihre Urheber bereit halten. Die Antwort darauf, die in der Dialektik der Begriffe zu finden ist, d.h. in der notwendigen Korrelation eines Begriff mit seinem Gegenbegriff, deren Wirken praktisch das gesamte Denken von Hegel dominiert und bei Platon in der Form der „Teilhabe“ eine eher obskure, nie wirklich deutliche Gestalt annimmt, kann an dieser Stelle nicht genügend Raum gegeben werden. Stattdessen wollen wir einer Fragestellung nachgehen, die wir zwar schon angerissen haben, der wir bis jetzt mehr oder weniger ausgewichen sind: Warum birgt der Anfang des Denkens solche Probleme in sich? Gibt es eine tieferliegende Struktur im Denken, die diese Gräben vor uns auftut? Dass wir einer solchen Struktur (wenn es sie den gibt) auf den Fersen sind, darf vermutet werden. Denn die Quantität der Schnittmenge philosophischen Gedankenguts, die wir bei Platon und Hegel antrafen, respektive der Grad der Ähnlichkeit in den Problemen, mit welchen sie zu kämpfen haben, lässt die Hoffnung keimen, dass es sich dabei um mehr als nur ein zufälliges Phänomen handelt.
Am Anfang der Untersuchung haben wir eine Frage (in mehreren verschiedenen Gestalten) gestellt: Kann sich eine Bewegung im Geiste selbst anstoßen? Können wir uns überhaupt selbst den Anfang setzten? Würden wir dann nicht nur uns selbst betrachten, statt einen konkreten Bewusstseinsinhalt? Allerdings müssen wir uns jetzt die Frage stellen: Haben wir wirklich bei Platon und bei Hegel Problematiken gefunden, die mit diesen Fragen konkordieren?
Was allen diesen Formulierungen unserer Eingangsfrage zugrunde liegt, ist das Phänomen des Selbstbezugs oder des vermittelten Rückbezugs auf sich selbst. Finden wir dieses wieder in unserer Untersuchung? Die Antwort darauf lautet: ja, und zwar genug. Zum Beispiel bei
• Parmenides: Das Eins soll aus sich selbst heraus bestimmt werden • Parmenides: Das Eins ist sowohl gewöhnlicher Begriff als auch durch sich selbst verstan-dene Einheit, eben Eins. • Hegel: reines Sein soll ohne weitere Bestimmung angegeben werden. Es muss also be-reits an sich selbst bestimmt sein. • Hegel: ein unmittelbarer Anfang müsste sich selbst anstoßen.
Damit haben wir einige Fälle von Selbstreferentialität nachgewiesen. Doch was bedeutet dies? Greifen wir das markanteste Beispiel heraus: das Eins, das sich selbst bestimmen soll. Wir haben gesehen, dass es dieses nicht zu leisten vermag. Im Jargon der Logik formuliert, könnte man sagen, das Eins ist unfähig, seine eigenen Wahrheitswerte anzugeben. Er bleibt deshalb in Bezug auf seine Wahrheitswerte unterbestimmt – d.h. es kann nicht determiniert werden, ob die Sätze, die Parmenides zur Bestimmung des Eins anführt, wahr oder falsch sind. Es liegt eine sogenannte Wahrheitswert-Lücke vor: die genannten Sätze sind weder wahr noch falsch. Damit ist ein Tatbestand erfüllt, der das Gesetz des tertium non datur, des ausgeschlossenen Dritten verletzt. Und diese beiden Beobachtungen, Selbstbezug und Wahrheitswert-Lücken, weisen uns auf eines hin: hier liegt eine Paradoxie vor.
Paradoxien können allesamt auf die Form gebracht werden, dass ein gewisser Sachverhalt von etwas gleichzeitig erfüllt und nicht erfüllt wird. Können wir wirklich Sätze dieser Form aus unseren obigen Beobachtungen extrahieren? Wiederum lautet die Antwort: ja, und zwar:
• Parmenides: Dass Eins kann nicht erkannt werden. Also kann über das Eins letztlich nicht gesprochen werden. Aber gerade haben wir eben dies getan. • Parmenides: sämtliche Bestimmungen des seienden Eins, die bei Punkt 2.1 mit einem Pfeil als Aufzählungszeichen angeführt werden. • Hegel: reines Sein, ohne alle Bestimmung oder Inhalt. Aber gerade haben wir es be-stimmt – nämlich in der Behauptung, ohne alle Bestimmung zu sein. • Hegel: Der Anfang ist sowohl vermittelt als auch unmittelbar.
Für die klassische Logik sind Paradoxien ein untragbarer Tatbestand. Dieser würde uns letztlich auf-zwingen, diese Sätze als sinn- und bedeutungslos zu klassifizieren, und weiter: auch alle Vorarbeit, die geleistet wurde, um zu diesen Resultaten zu kommen, wäre vergebens gewesen. Mehr noch: ex contradictione quodlibet, das Gesetz des Aristoteles, nachdem aus einer Kontradiktion jeder beliebige Schluss gezogen werden kann, würde hier Anwendung finden. Diese Konsequenzen müssen nun adressiert werden, nachdem wir Paradoxien festgestellt haben.
Sind die obigen paradoxen Sätze sinnlos? Meiner Ansicht nach kann hierauf nur geantwortet werden: nein, sie sind nicht sinnlos, und keinesfalls bedeutungslos. Sowohl ich, als auch Platon, und hoffentlich inzwischen auch der Leser verknüpfen mit dem Satz „Über das Eins kann nicht gesprochen werden“ eine definite Aussage. Diese besteht in der Feststellung der Problematik, und ist ebenso in ihrer Bedeutung verwoben mit allen den Ausführen, die wir oben getätigt haben, indem sie sie auf den Punkt bringt. Sind alle unsere Beobachtungen, sowie die Analysen des Parmenides bedeutungs- oder zwecklos? Wiederum muss die Antwort lauten: nein, keinesfalls. Denn selbst wenn wir nur die Problematiken eines Anfang des Denkens herausgestellt haben, ohne diese zu lösen, haben wir doch immerhin dies bewerkstelligt; und hoffentlich wird mir der Leser zugestehen, dass (zumindest den meisten) der Sätzen der obigen Untersuchung in irgendeinem Sinne eine gewisse bedeutungstragende Funktion zukommt, als auch in der Fixierung einer Problematik ein Sinn und Zweck einbeschlossen ist – gänzlich abgesehen von der Tatsache, dass wir im gegenteiligen Fall im selben Atemzug komplette Staffeln von Gedankengängen des vielleicht größten Philosophen der Geschichte als bedeutungslos verwerfen müssten.
Kann auf obige paradoxe Sätze das Gesetz des Aristoteles angewandt werden? Versuchen wir uns an einem Beispiel: Über das Eins kann nicht gesprochen werden, also ist Julius Cäsar die Zahl 44. So abstrus dieser Schluss erscheinen mag; genau dies kann mittels Aristoteles Gesetz gefolgert werden. Ich kann nicht für den Leser sprechen, aber für meiner Meinung nach muss eher das Gesetz des ex contradictione quodlibet verworfen werden, als dass die Schlussfolgerung akzeptiert werden kann, dass Julius Cäsar die Zahl 44 ist, weil Platon Probleme bei seiner begrifflichen Setzung des Eins hat.
Wir wollen den logischen Blickwinkel noch etwas vertiefen: Den Bereich der Sprache, mit dem wir in unserer Untersuchung zu schaffen haben, nämlich den Anfang des begrifflichen Denkens, können wir als logisches System betrachten, mit Axiomen, Aussagen, und Schlussfolgerungen (wäre dies nicht möglich, könnten wir keine deduktiv gültigen Schlüsse ziehen und unser gesamtes Unternehmen wäre von Beginn an sinnlos). Wenn wir jedoch an unser Denken die Systematik der klassischen Logik, also insbesondere deren Schlussregeln anlegen, müssen wir einige, namentlich die oben genannten paradoxen Aussagen, daraus ausschließen, weil sie kontradiktorisch sind. Gerade jedoch haben wir dafür argumentiert, dass diese trotz ihrer paradoxen Natur einen bedeutungstragenden Charakter haben. Was nichts anderes bedeutet, als dass wir uns entscheiden müssen: entweder, wir geben einige (bedeutungsvolle) Sätze auf, und beschneiden unser logisches System damit künstlich in seiner Aussagekraft, oder wir akzeptieren die auftretende Inkonsistenz und verwerfen die Position der klassischen Logik. Vollständige Aussagekraft eines logischen Systems und dessen Konsistenz sind damit zwei Momente, die sich wechselseitig ausschließen.
Das Phänomen des Abtausches zwischen Aussagekraft und Konsistenz innerhalb eines logischen Systems ist weder neu noch unbestätigt. Gödel hat mit seinem berühmten Unvollständigkeits-Theorem eben dies bewiesen : dass jede formale Systematik entweder unvollständig oder inkonsistent sein muss.
Und auf eben diesen Sachverhalt treffen wir hier: Das Grundproblem der Vermitteltheit bzw. Unmittelbarkeit des Anfangs bedeutet letztlich nichts anderes, als dass ein Anfang sich immer auf irgendeine Weise selbst rechtfertigen und bestätigen muss. Eben dies liegt in der Natur des Anfangs und seiner exponierten Stelle im Denken, ein Grenzstein zu sein, hinter dem nichts mehr liegt. Deshalb muss er sich selbst Stütze sein, was, logisch formuliert, bedeuten muss: er muss sich seine Wahrheitswerte selbst zuordnen, was sich aber grundsätzlich als schwierig gestaltet. Dieser Selbstbezug, und sein Korrelat, die Wahrheitswert-Lücke, führen zur Inkonsistenz, und diese kann nur mittels einer Beschränkung des aussagelogischen Raums abgewehrt werden, den das betreffende System aber grundsätzlich gänzlich ausfüllen könnte.
Wenn man nicht akzeptieren will, dass bedeutungstragende Sätze einfach verworfen werden, muss man sich zum Faktum der Inkonsistenz anders positionieren, als es die klassische Logik tut. Dass dieses im Laufe der Zeit obsolet geworden ist, ist meine Überzeugung: es ist nämlich zu bemerkten, dass nicht nur unsere Untersuchung gute Gründe hervorgebracht hat, um Denkgesetze wie das tertium non datur oder das ex contradictione quodlibet zu verwerfen, sondern auch ein großer Anteil der logischen Diskurse des aktuellen philosophischen Zeitgeschehens von Paradoxien handeln, obwohl sie nach Maßgabe der klassischen Logik das Denken und Sprechen dort ein abruptes Ende finden müssten. Letztlich besteht der einzige meiner Ansicht nach gangbare Weg in der Integration von kontradiktorischen Sätzen in eine neue logische Systematik, die sie nicht als sinnlos abtut, sondern sie produktiv verwendet: eine dialektische Logik.