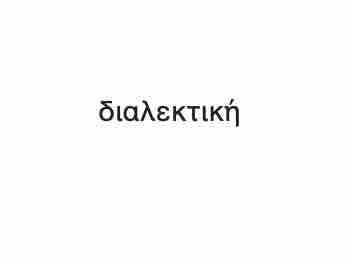„Es ist noch Nichts und es soll Etwas werden.“ (Hegel, WdL I, S. 73) Jeder, der jemals etwas Neues begonnen hat, wird davon berichten können, dass diese Dichotomie nicht immer einfach zu überwinden ist. Sollte aber der Anfang eine besondere philosophische Stellung innehaben, müsste seine Relevanz über die reine Sonderstellung als erster Abschnitt eines folgenden Ganzen hinausgehen: der Anfang könnte für eine philosophische Theorie richtungsweisend sein, so dass von seiner Wahl und Gestaltung das Folgende maßgeblich abhängt. Generell sollte dabei der Anfang einer Philosophie von ihrem Fundament unterschieden werden; die Annahmen, die im Voraus zugrunde gelegt sind, auf was man sich beruft, ob es nun ganz allgemein Vernunft oder Verstand sind, ein Satz aus vorgefertigten Prämissen oder ein ausgesuchtes Prinzip müssen nicht notwendigerweise mit dem Anfang zusammenfallen: Descartes kann hier als Beispiel dienen, der sich zu den nicht hintergehbaren Grundannahmen erst durcharbeiten musste. Gleichwohl können Anfang und Grundlegung zusammenfallen – eine Philosophie, die sich ihrer Prämissen bewusst ist und diese zu Beginn klarstellt scheint mehr als wünschenswert. Anfang und Fundament einer Philosophie sollten also zusammenfallen, so dass diese von Beginn an selbstreflektiert ist. Selbstbezüglichkeit ist somit ein Qualitätsmerkmal: eine philosophische Theorie begründet sich selbst dadurch, dass sie ihr Ausgangsmaterial reflektiert.
Diese Arbeit will näherbringen, dass der Anfang in der Philosophie bei begrifflichen Theorien, als eine Schwierigkeit auftritt, die letztlich nicht ohne Widerspruch überwunden werden kann: der Selbstbezug, realisiert durch Reflexion von Prämissen und Methodik, wird ihr bereits am Beginn zum Verhängnis. Jedoch wird sich zeigen, dass der Anfang dadurch nicht ein isoliertes, auf eben den Beginn beschränktes Problem darstellt, das wenn gelöst, ohne Weiteres ad acta gelegt werden kann, sondern sich als ein methodisches Brennglas zeigen wird, das eine theorieübergreifende Problematik zu Tage fördert. Der Begriff der Dialektik im Titel dieser Arbeit wird dabei als das mehrschichtige, in sich verschränkte Auftreten eines Anfangsproblems verstanden und dargestellt werden, das als Widerspruch in Objekt- und Metaebene zu finden ist, also in Aufstellung von und Reflexion über ein philosophisches System.
An den Beispielen von Platons Parmenides und Hegels Wissenschaft der Logik wird zu zeigen versucht, wie wichtig es ist, ob das Anfangsproblem überhaupt als solches erkannt, und wenn ja, wie dazu Stellung genommen wird. Dabei wird ersichtlich werden, dass es, sofern es nicht von Anfang an angenommen und analysiert wird, sich in den weiteren Verlauf der Theoriebildung verschleppt; wird es ungenügend anerkannt oder nicht konsequent als Systematikum in die Theorie eingegliedert, transferiert sich das Anfangsproblem lediglich auf eine neue Ebene, tritt also nur in veränderter Gestalt wieder auf. Daraus wird gefolgert werden, dass sein Problemgehalt in Form des Widerspruchs der Theorie zu sich selbst letztlich als solcher akzeptiert werden muss und die strenge Forderung nach Widerspruchsfreiheit bei den beiden gewählten Theoriebeispielen schon des Anfangs wegen nicht aufrechterhalten werden kann. Anstatt jedoch aufgrund eines Mangels an Konsistenz die jeweilige Theorie abzuwerten, wird zu zeigen versucht, dass die Dialektik des Anfangs in Gestalt einer inneren Antinomie, weil notwendig auftretend, als positives Strukturelement der Theoriebildung gewertet werden muss und nicht als systematisches Defizit verstanden werden oder gar den Verwurf der Theorie als Ganzes nach sich ziehen sollte.
Widerspruchsfreiheit darf freilich nicht leichten Herzens aufgegeben werden; nur wenn eine Antinomie streng nachgewiesen wird, notwendigerweise auftritt und ihre Unlösbarkeit erwiesen ist, kann Inkonsistenz anerkannt werden. Dadurch wird gleichzeitig die Position bezogen, dass eine kompromisslose Forderung nach Konsistenz nicht haltbar ist und kein unumgängliches Postulat darstellt.
Dem Selbstbezug als Qualitätsmerkmal einer philosophischen Erörterung soll auch diese Arbeit gerecht werden: deshalb wird im Folgenden der Anfang dieser Arbeit mit einer kurzen Bestandsaufnahme bezüglich des Begriffs der Dialektik gemacht.