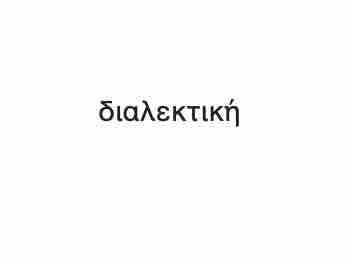Dialektik: ein gern gemiedener Begriff
Dem Begriff der Dialektik, einst eines der Zentralgestirne der Philosophie, haben die modernen Zeiten stark zugesetzt. Dialektik inkorporiert, auf die eine oder andere Weise, den Widerspruch, und steht damit der modernen Logik konträr gegenüber. Auf dem europäischen Festland genießt er in der zeitgenössischen kontinentalen Philosophie noch eine relativ anerkannte Stellung und taucht in mehreren Zusammenhängen und Gestalten auf, in der anglo-amerikanischen Sphäre jedoch findet er sich selten bis gar nicht ein. Der Unterschied ist so ausgeprägt, dass man in die philosophische Landkarte der Dialektik nicht viel mehr zeichnen müsste als die geographischen Grenzen. Exemplarisch für das Ausmaß des Grabens ist, neben vielen anderen, Karl Poppers der sich nicht mit einem philosophisch-fachlichen Bombardement der Dialektik zufrieden gab, sondern ihr eine Mitverantwortung am Aufstieg des Faschismus des vergangenen Jahrhunderts in Europa zusprach1. Diese Auffassung ist das Extrem der einen Seite, vereinzelt haben zeitgenössische Philosophen auch versucht den Brückenschlag versucht2, doch diese Versuche blieben meist isoliert und wenig erfolgreich.
Eine spezifische Strömung in der modernen Logik ist jedoch erwähnenswert, weil sie sich zwar klar für eine Seite der statischen Aufteilung der Lager für und gegen Dialektik entscheidet aber als Logik die Methoden und Mittel der anderen Seite für sich verwendet: die parakonsistente Logik (gelegentlich auch „transkonsistene Logik“ oder „dialektische Logik“ genannt) sucht per logischer Analyse die Annahme zu untermauern, gewisse Widersprüche seien unvermeidbar und müssten deshalb produktiver, positiver interpretiert werden, sie müssten ins logische Konstrukt eingefügt werden – ganz im Gegensatz zum üblichen modus operandi in der Logik, wo Widersprüchlichkeit innerhalb eines Kalküls nur dazu führen kann, dass dasselbe als fehlerhaft angenommen werden und modifiziert oder, ist dies nicht möglich, gänzlich verworfen werden muss. Einen solchen unumgänglichen Widerspruch nennt sie ein „dialethia“: das Lügner-Paradoxon wäre ein prominentes Beispiel dafür.
Die diametrale Stellung der Positionen zueinander was Dialektik betrifft, sowohl der Kontrast zwischen der anglo-amerikanischen Philosophie und der des europäischen Festlands als auch der parakonsistenten Logik zum Rest der modernen Logik, lässt sich bereits ohne tieferes Quellenstudium festmachen. Ein Beispiel dafür ist die Stanford Encyclopedia of Philosophy3, ein durchaus umfangreiches, allgemein zugängliches und auch geschätztes elektronisches Nachschlagewerk für Philosophie, das keinen Eintrag für Dialektik hat. Seit Sommer 2013 findet sich darin ein Artikel über die parakonsistente Logik4 (obwohl diese Art von Logik bereits seit gut 20 Jahren existiert)<-nachschaun.
Dass diese Arbeit der Dialektik nicht dermaßen feindlich gegenübersteht, lässt sich schon anhand des Titels erahnen. Um Argumente auf der Seite des Begriffs in die Waagschale zu werfen, wären mehrere gangbare Wege vorstellbar: eine oberflächliche Variante wäre es, eine Sammlung an Positionen für und gegen die eine oder andere Seite zu liefern, und zu bemerken, dass allein durch die Existenz des Diskurses folgern lässt, dass die Wichtigkeit des Begriffs nicht verschwunden sein kann. Eine andere Möglichkeit wäre es, den historischen Wandel des Stellenwerts des Begriffs zu untersuchen, die vielfältigen Bedeutungsschattierungen aufzuspalten, oder den Verlauf der Diskussion darüber nachzuzeichnen und zu analysieren. Während die erste Möglichkeit zu leichtgewichtig ist, würden die zweite den Rahmen sprengen. Ein Diskurs darüber, ob es nicht selbst für die Gegner der Dialektik eine Übung in Dialektik sei, diese zurückzuweisen (wenn auch nur zu dem Zweck die Opposition zu stärken) mag auf den ersten Blick wie eine logische Spitzfindigkeit erscheinen – aber das Ausweichen auf eine höher gelagerte Ebene ist auch ein Spielzug, der sich durch den methodologischen Horizont der Dialektik zieht und deshalb selbst schon ein systematisches Moment der Dialektik darstellt. Während es unvermeidlich ist, auf Gegenargumente und konträre Positionen zum Begriff der Dialektik einzugehen, will diese Arbeit jedoch an vorderster versuchen den Fokus zu verengen auf die positiven Gründe für eine Seitenentscheidung zu Gunsten der Dialektik: insbesondere die Frage, inwieweit Dialektik mechanisierbar ist, ob und welche systematischen Elemente auftauchen, wo und wie sie vergleichbar sind und wie sie in Zusammenhang gebracht werden können. Im Sinne der Konzentration auf Systematik werden einige Verwendungsarten des Begriffs, viele Diskurse darüber, und noch mehr Einzelauftritte des Begriffs auf der historischen Bühne im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet. Es werden also Exempel ausgewählt, die in ihrer jeweiligen Ausprägung systematische Rückschlüsse zulassen und einen möglichst geschlossenen systematischen Horizont schaffen. Die Schlüssigkeit der Gründe für diese Auswahl und der genaue Umriss dieser Hinsicht werden sich erst im Verlauf der Arbeit nach und nach zeigen – für den Anfang muss das Schlagwort eines dialektischen Mechanismus taugen. Auch wenn diese Arbeit keinen allgemeinen dialektischen Mechanismus herausarbeiten wird, so erscheint doch die Frage nach dem Weg zu diesem Ziel anhand der oft genug zugespitzten Kontroverse über den Begriff lohnenswert.
Ebenso wie viele Fürsprecher der Dialektik nicht beachtet werden, werden auch die Gegner und ihre Einwände in späteren Kapiteln nur dann erwähnt, wenn die Kehrseite ihrer Argumente einen Beitrag liefern kann den Weg zu einem dialektischen Mechanismus zu konkretisieren. Die Hoffnung dabei aber bleibt, dass selbst die Opponenten der Dialektik eine Abschrift des Versuchs, den Weg zu einem dialektischen Mechanismus zu weit als möglich zu umreißen nützlich finden könnten, insofern die Zielrichtung auf die Systematik vielleicht sogar neue Munition für die Gegenseite des Lagerkampfs liefert – sofern man dieser Dialektik nicht aus im Vorhinein getroffener Grundsatzentscheidung gegen jede Form von Dialektik selbst im zartesten Anklang entsagen will. Dementsprechend wäre diese Arbeit nur für denjenigen, der Dialektik so negativ interpretiert dass er schon bei der ersten Erwähnung die Flucht ergreift, völlig nutzlos. Diese Einstellung scheint schon auf den ersten Blick zu radikal zu sein – dass aber auch ein zweiter Blick sie kaum rechtfertigen kann, versucht der folgende Abschnitt darzustellen.
Das Klischee des Obskuren
Mit dem Begriff der Dialektik wird oft assoziiert, dass der entsprechende dialektische Sachverhalt für theoretische Belange nebulös sei, kaum oder nicht mit rationalem Denken durchdringbar, in seinen Zusammenhängen schwer oder nicht auflösbar sei, bis hin zum Punkt dass Widersprüche aus der konkreten Thematik filtriert werden und es zur ultimativen Resignation kommt: Dialektik transzediere das Denken.
Diese Arbeit kann auch als eine Materialsammlung angesehen werden, um den dazu konträren Standpunkt zu untermauern, aus dessen Perspektive diese Auffassungsarten des Begriffs, etwa in der Reihenfolge obiger Erwähnung, oberflächlich, irreführend, bis dem philosophischen Denken direkt schädlich sind. Einen der Eingänge in den Irrgarten markiert das Prädikat „unauflösbar in den Zusammenhängen“: zwar ist es wahr, dass dem Begriff der Dialektik fast immer Selbstbezug inhäriert – wäre aber Selbstbezug allein ein Kriterium dafür, den Standort eines Begriffs oder außerhalb eines dem Denken zugänglichen Bereiches zu bestimmen, wäre jede Dichotomie davon betroffen: Ursache und Wirkung sind ebenfalls nicht isoliert voneinander vorstellbar. Dass die beiden Begriffe von ihrem jeweiligen Gegenstück unterscheidbar sind, hat nur insofern mit ihrem Bezug aufeinander zu tun, als dieser dadurch erst ermöglicht wird. (Vgl Nagarjuna). Einen Zusammenhang als unauflösbar anzuerkennen bedeutet nicht dass er nicht betrachtet werden könnte, nicht dass keine verschiedenen Seiten an ihm zu finden wären und auch nicht, dass es in ihm keine unterscheidbare Bestandteile geben würde. Insbesondere bedeutet es nicht, dass es keine Systematik zu erkennen gäbe.
Dass eine Thematik schwer durchdringbar ist – und man die Schwierigkeiten unter das Schlagwort „Dialektik“ verfrachtet und deshalb sich wahlweise genötigt oder versichert genug fühlt, vom Thema oder der ganzen Fragestellung die zu diesem Punkt führte Abstand zu nehmen kann ebenfalls keinen allgemein anerkennbaren modus operandi darstellen. Während die folgenden Kapitel Beispiele für diese Abkehr darstellen als auch die Fehlannahmen und -schlüsse die dazu führen, kann man an dieser Stelle bereits anführen, dass diese Attitüde eine Fehlinterpretation von Pragmatismus im philosophischen Denken in sich birgt: man müsse besonders in der Philosophie wissen, die richtigen Fragen zu stellen und von falschen Fragestellungen ablassen können. Den Gegnern der Dialektik haben dabei gemeinsam, diese Abwägung als radikalen Schnitt zu interpretieren und immer dort wo Dialektik auftritt Schwarz und Weiß entsprechend zu sortieren. Dass dabei Gegenstände der Untersuchung schnell unter den Tisch fallen können, ist ersichtlich, wenn die Konzentration auf die richtigen Fragstellungen die Verengung auf hinreichend einfach oder ausreichend klar beantwortbare Fragen darstellt. Den Pragrmatismus der eindeutig, hinreichend einfach beantwortbaren Fragen als Generalkriterium für sinnvolle Fragestellungen zu werten, bedeutet dem Mann zu gleichen, der nachts seine verloren gegangene Uhr nur dort sucht, wo ausreichendes Licht zur Verfügung steht.
Den Begriff ins einfach ins Land des Obskuren abzuschieben kann noch aus einem anderen Grund unproduktiv sein: jeder triftige Versuch in die Richtung muss sich in irgendeiner Weise mit dem Begriff beschäftigen. Der offensichtliche Einwand, dies trotzdem nicht zu tun, würde wohl inhärieren, auf die unpräzise Gestalt des Begriffs zu verweisen, sei es in disparaten Verwendungen oder in Bezug auf seine Mehrschichtigkeit – und dass dadurch die Aufgabe von vornherein als müßig anzusehen wäre. Dem kann man entgegnen, dass die Präzisierung eines Begriffs ins Aufgabenfeld eines Philosophen fällt. Es ist schwer vorstellbar, dass es andere Gründe übrigen bleiben, die Dialektik als Begriff kategorisch ablehnen, die nicht aus dem Bereich nicht weiter ausgeführter und damit nicht substanziierter Haltungen oder Meinungen stammen, aber gleichzeitig nicht zurück zur Aufgabe führen, den Begriff zu präzisieren, sei es auch ausschließlich zu dem Zweck, mit dem Begriff der Dialektik einen Gegenpol zu einem als allgemein anerkennbaren Denksystem zu schaffen. Selbst wenn man den Begriff und seinem Umfang als halt- bzw. bedeutungslos darstellen will, muss man sich trotzdem noch mit ihm beschäftigen, will man sich nicht lediglich auf eine induktive Indizienlage gegen ihn berufen, z.B. eine fehlende Produktivität. Alle Argumente, die sich von vornherein darauf festlegen, sichnicht mit dem Begriff oder einer seiner möglichen Bedeutungen beschäftigen, ihn unter die Anklage der Ominosität stellen, ohne die Anklage präzise gestalten zu können, wobei eine Klärung des veranschlagten Verständnis davon das Minimum an Vorarbeit darstellen würde, was in sich selbst ein Vorhaben nicht ohne Anspruch ist, werden von einer Spielart der Dialektik eingeholt: die Prämisse, die sich in der Annahme ausdrückt, Dialektik (in einer speziellen Form oder als Ganzes) sei zurückzuweisen, gerät selbst ins Wanken. Der Impuls weg von der Dialektik, die Absicht sich abzugrenzen gegen Dialektik führt – nicht ohne eine gewisse Ironie – zur Dialektik zurück und damit zweifach das Gegenteil der ursprünglichen Intention erreichen: einerseits ist die Abkehr nicht gelungen und führt dorthin wo man gerade nicht wollte; andererseits ist der ungewollt beschrittene Pfad selbst ein Beispiel für einen dialektischen Bezug.
Nun könnte man einwenden, dies sei gerade der Beweis, und auch Beweis genug, dass das Unternehmen, sich mit Dialektik zu beschäftigen, von Anfang an als fruchtlos angesehen werden muss. Neben dem offensichtlichen ad-hoc-Charakter dieses Arguments, das in eine höhere Ebene ausweicht um die anfänglich gemachte Prämisse zu rechtfertigen, ist es der Regress, der sich hier abzeichnet, der ein Problematik für sich darstellt, die nicht verschwindet wenn man sie ignoriert. Entzieht man sich nicht der Aufgabe zu klären, was genau hier am Wirken war, ist man angewiesen darauf, das Verhältnis der auf der höheren Ebene wiedergeborenen Annahme, Dialektik sei zurückzuweisen, zur vorangegangen Auffassung von Dialektik zu betrachten, wodurch das erneute Auftauchen des Begriffs im Diskurs auf dieser Ebene wiederum nicht vermieden werden kann.
Der letzte Strohhalm, nachdem man greifen kann besteht darin, den Bereich des Diskurses im Allgemeinen auf einen zu beschneiden, in dem kein Selbstbezug, auch kein vermittelter, auftritt. Neben der Tatsache, dass eine solche Selbstbeschränkung den Raum des Diskurses und damit die Gültigkeit der daraus gezogenen Folgerungen stark restringiert, stellt sie lediglich eine praktische Vorannahme und keine theoretisch fundierte Entscheidung dar und kann diese Beschränkung nicht rechtfertigen.
Hegel: Wissenschaft der Logik
Hegel hat zum Anfang ein besonderes Verhältnis: zum Beispiel schrieb Hegel die Phänomenologie des Geistes zuerst fertig, bevor er ihr den Anfang einer Einleitung vorsetzte, der deshalb bereits viel der folgenden Substanz in sich komprimiert; die Einleitung zur Wissenschaft der Logik ist ähnlich gehaltvoll. Des weiteren hat Hegel über seine Schriften hinweg die Welt dialektisch durchdrungen und setzt dafür an mehreren Anfangspunkten an. Am prinzipiellsten ist wohl der Anfang der Wissenschaft der Logik, wo Hegel nicht nur den Grundstein seiner Kategorienlehre setzt, sondern auch ganz explizit über deren Anfang und die Schwierigkeiten dabei reflektiert – die in seinen Werken ständig auftretende Selbstbezüglichkeit der Begriffe führt also auch dazu, dass sich Hegel auf sein eigenes Vorhaben bezieht indem er die Problematik des Anfangs als Exposition dem eigentlichen Anfang seiner Kategorienlehre voranstellt.
Hegels Denken und Schreiben ist in seiner hochabstrakten, dialektischen Weise nicht nur anspruchsvoll, sondern auch wegen seiner Losgelöstheit von üblicher Diktion ein Problem an sich: während bei manch anderen Philosophen der Bezug zur üblichen Verwendung der Sprache dadurch klar ist, dass im Großen und Ganzen die übliche Sprache verwendet, haben Hegels Rezipienten diese Brücke dazwischen eher selbst zu meistern. (Hendrich oder Hösle: Hegels traumhafte Sicherheit im Abstrakten). (Hegel übliche Satzform). Hegel belässt es nicht dabei, die Begriffe der Sprache philosophisch zu präzisieren oder zu erläutern – er positioniert sich am anderen Extrem des Spektrums dadurch, dass er die Begriffe seinem System zurechtschneidert und dann in spezifischer, wiederkehrender Weise darin einordnet. Zumindest ist es leicht bei Hegel den Anfang zu verorten: im doppelten Sinn am Anfang der Wissenschaft der Logik.
Der Anfang vor dem Anfang vor dem Anfang
Die Wissenschaft der Logik ist Hegels zentrales metaphysisches Bauwerk, in dem er nach der Kategorie sucht, die sich selbst aussagt. Bevor die Kategorienlehre als solche überhaupt beginnt, setzt Hegel mit einer Diskussion der künftigen Methode an. Eine Wissenschaft der Logik wie er sie intendiert hat „ohne vorangehnde Reflexionen von der Sache selbst anzufangen“1. In jeder anderen Wissenschaft kann Inhalt und Methode getrennt voneinander reflektiert werden, nicht so aber in der Wissenschaft der Logik; sie kann keine „Regeln oder Gesetze des Denkens voraussetzen, denn sie machen einen Teil ihres Inhalts selbst aus und haben erst innerhalb ihrer selbst begründet zu werden“2. Besonders bei Hegels Anspruch, in der Wissenschaft der Logik den „Begriff selbst der Wissenschaft überhaupt“3 und das „Denken oder bestimmter das begreifende Denken“4 ohne Einschränkung als Ganzes zum umreißen, kann in der Hinführung dazu keine Bestimmung, Grundlegung, noch nicht einmal eine Rechtfertigung stehen, weil dies den Gegenstand der zukünftigen Betrachtungen im Voraus prädizieren würde. Hegel will sich in den Vorbemerkungen nach eigenem Bekunden darauf beschränken, „in räsonierendem und historischem Sinne den Gesichtspunkt, aus welchem diese Wissenschaft zu betrachten ist, der Vorstellung näherzubringen“5.
Offenkundig genug steht Hegel schon damit im Widerspruch mit sich selbst. Einen Betrachtungswinkel zu etablieren, „in räsonierendem und historischen“ oder ganz gleich welchen Sinne, erfordert schließlich bereits irgendeine Form von innerer Auffassung desselben, und eine gewisse Form des abstrakten Denkens um dorthin zu gelangen. Dem unmittelbaren Selbstbezug kann sich Hegel nicht erwehren: schließlich malt Hegel keine Bilder sondern benutzt die Sprache als Medium, deren Abstraktionsgrad allein schon immer entsprechend abstraktes Denken voraussetzt. Wäre dies nicht gewissen Regelmäßigkeiten unterworfen (die Hegel erst im späteren Verlauf untersuchen und herausstellen will), könnte niemand seine Ausführungen an dieser Stelle verstehen. Die abgeschwächte Formulierung die er benutzt, „den Gesichtspunkt … der Vorstellung näherzubringen“ scheint diesen Widerspruch hinter sich verstecken zu wollen, jedoch kann dies nicht gelingen, da räsonierende und historische Reflexion (auch nach Hegels eigenem Maßstab) zu den Möglichkeiten des wissenschaftlichen Vorgehens gehören – wo aber doch der „Begriff selbst der Wissenschaft überhaupt“ erst im Folgenden erarbeitet werden soll. Räsonierende oder historische Zusammenhänge sind nicht durch Gottes Gnaden gegeben oder durch sich selbst gesetzt: das begreifende Denken muss bemüht werden.
Dass Hegel hier den ersten auftretenden Widerspruch unterschlägt nimmt diesen keineswegs seine Relevanz. Das systematische Problem hier ist eines das an Sprache und Zeit gebunden ist: welche Sprache soll Hegel benutzen, wenn die wissenschaftliche Sprache als notwendig auftretendes Korrelat, als Indikator wissenschaftlichen Vorgehens ein unerlaubtes Mittel darstellt? Wie kann er im Vorhinein, in der Einleitung, Wissenschaftlichkeit in der Einleitung bemühen, wenn die Gesetz- und Regelmäßigkeiten des begreifenden Denkens erst viele Seiten später angegangen und aufgestellt werden sollen? Der Vorgriff auf Zukünftiges muss erfolgen, auch wenn Hegel sich herauszuwinden versucht: gibt er an, wie „diese [eigene Betonung] Wissenschaft zu betrachten ist“, nimmt er eine scheinbare Einschränkung vor. Er stellt sie zwar für sich als einzelne heraus, aber scheinbar auch gleichwertig neben die anderen Wissenschaften, zum Beispiel der historischen Wissenschaft – diese eine, neben anderen, für die zwar anderes Regelwerk gelten mag, jedoch historisch soll sie auch anfänglich, wo ihr Gegenstand und ihre Regelmäßigkeiten noch nicht etabliert sind, betrachtet werden können. Unabhängig davon wie stark historisch er im Weiteren verfährt, kann diese gleichwertige Stellung keinen Bestand haben, im Gegenteil: stellt er zum Beispiel die historische Reflexion der Wissenschaft der Logik voran (und genau das unternimmt er in der Einleitung teilweise), ginge die historische Reflexion der logischen voraus und wäre ihr damit übergeordnet. Dies wiederum aber steht im scharfen Widerspruch dazu, dass die Wissenschaft der Logik daraus bestehen soll, das „Denken, oder bestimmter das begreifende Denken“ in ihr abgehandelt werden soll. Eine gewisse Portion begreifenden Denkens kann nach Hegels eigenem Anspruch nicht einfach aus dem erst später Folgendem herausgelöst werden um für die anfängliche, hier diskutierten Problematik verwendet werden zu können.
Nun könnte man einwenden, etwas zu benutzen sei nicht das gleich wie es zu untersuchen, etwas mit dem Denken zu erfassen nicht das gleiche wie dasselbe zu analysieren, weshalb es hier übertrieben wäre, von einem Widerspruch zu reden. Diese Argumentation würde aber übersehen, wie absolut es Hegel mit der Wissenschaft der Logik meint: „Die Logik kann keine … Regeln und Gesetze des Denkens voraussetzen, denn sie machen einen Teil ihres Inhalts selbst aus und haben erst innerhalb ihrer begründet zu werden … was sie ist, kann sie daher nicht voraussagen, sondern ihre ganze Abhandlung bringt dies Wissen von ihr selbst erst als ihr Letztes und als ihre Vollendung hervor“6. Es mag wie eine Spitzfindigkeit klingen, aber wenn keine Regeln oder Gesetze vorausgeschickt werden dürfen, wurde eine Regel vorausgeschickt: nämlich keine solche vorausschicken zu dürfen. Darüber hinaus bleibt obige Problematik bestehen: historisches Denken ist nicht streng isoliert vom logischen (auch in der Art wie Hegel „logisch“ versteht). Was soll eine historische Betrachtung dann, an den Anfang gestellt, leisten können wenn das grundlegende Prinzip des Denkens erst eruiert werden soll? Letztlich ist es Hegels eigener Anspruch, dass sich das Objekt seiner Analyse aus sich selbst entwickelt. Mit Vorbemerkungen die anderen Hinsichten entspringen muss die Diskussion also zwangsläufig mit sich selbst in Zwist geraten.
Die Dialektik des Anfangs, in der Form in der sie Hegel betrifft, tritt hier erstmalig auf. Ganz gleich welche Betrachtungen er der eigentlichen Untersuchung voranstellen will, sind diese aufgrund ihrer Anfänglichkeit ohne Bezug auf das im weiteren Verlauf folgende. Damit stehen die anfänglichen Gedanken die Hegel niederschreibt für sich allein und ohne Orientierung an den Maßstäben des begreifenden Denkens, die den späteren Untersuchungsgegenstand ausmachen. Dadurch stellt sich die Frage, auf welche Art von Denken sich Hegel am Beginn überhaupt berufen kann – schließlich wird er davon ausgehen, dass sein Geschriebenes sinnvollen Zusammenhang bietet und entsprechend von seinen Rezipienten erfasst werden kann.
Hegel versucht es damit, aufzuzeigen, was die Logik als Wissenschaft des Denkens nicht ist: so kann etwa nicht Form von Inhalt getrennt werden, die Regeln des Denkens abstrahiert von ihrem Inhalt nachgezeichnet werden können, weil „die Regeln des Denkens … Gegenstand sein sollen“7 der Wissenschaft der Logik, „ihren eigentümlichen Inhalt ausmachen“8 sollen. Ebenso wäre es missverständlich, „eine fertige Wert außerhalb des Denkens“9 anzunehmen, dass zunächst „das Denken für sich leer sei“10, dass „es etwas Mangelhaftes sei“11, das sich erst am Inhalt zu vervollständigen habe, mehr noch, „dem Gegenstande sich fügen und bequemen“12 müsse.
Nach Hegel entwickelt sich das Denken aus sich selbst heraus, ist keine nachträglich erkannte Übereinstimmung von äußerlicher, real und unabhängig vom Denken existierenden Welt und seiner selbst. Aber genau mit diesen Ausführen unterminiert er auch deren Bedeutung und Sinn und Zweck: das Denken entsteht durch sich selbst, aber trotzdem scheint es zuerst notwendig vorauszuschicken was es nicht ist, d.h. nach Hegels eigenem Bekunden einen Referenzpunkt in der Vorstellung zu schaffen, eine Perspektive aufzubauen, die darauf hinführt. Wie kann das Denken so wie es Hegel in der Kategorienlehre entwickeln will diese Beschreibung nötig haben? Mehr noch: wenn Hegel vorausschickt was das Denken seinen Ansichten gemäß nicht ist, bzw. wie nicht an das Thema herangetreten werden soll, besteht darin schon ein Vorgriff auf die nachfolgenden Untersuchungen, eine Einordnung anhand diametraler Positionen und Meinungen, und auch eine Bestimmung der Methode durch Negation anderer.
Ohne es explizit zu machen bewegt sich Hegel hier in einem sprachlich-konzeptionellen Vakuum. Auf welche Verständnisart soll man sich berufen, wenn man die Einleitung liest? Diejenige die im späteren Verlauf aufgezeigt wird, also eine Untersuchung des begreifenden Denkens überhaupt, kann nicht herangezogen werden, weil sie in der Zukunft liegt und jeder Vorgriff nach Hegels eigenem Bekunden sträflich wäre. Von den anderen Auffassungs- und Denkarten, die erwähnt werden, distanziert sich Hegel, so dass diese ebenfalls nicht als Maßstab angesetzt werden können. Was übrig bleibt ist vielleicht eine lose Referenz auf das übliche Verständnis von Sprache und Geist, eine Art common sense wie sie in Hegels Zeiten Bestand hatte. Dass es nicht diese Art von Denken sein kann, auf die Hegel hinaus will, deren Regeln und Gesetzmäßigkeiten er darstellen will, ist offensichtlich. Wenn es aber erst – qua diesen konkreten hinführenden Ausführungen in der Einleitung – eine Loslösung, ein Abstoßen von anderen Denk- und Herangehensweisen braucht, kann man noch behaupten, das die Wissenschaft der Logik unabhängig davon ihre Form, Inhalt und Gegenstand entwickelt? Bräuchte es diese dialektische Einbettung nicht, die die Einführung behauptet, hätte diese keine Bedeutung, Hegel hätte sie wohl kaum geschrieben. Hat sie aber Sinn und Zweck, ohne dass sie sich auf das Denken und dessen Regeln berufen kann, welche erst im Folgenden untersucht und beschrieben werden, steht sie für sich selbst und kann deshalb den Leser auf das im späteren Verlauf folgende hinführen und ist damit auch Bestandteil des gesamten Unternehmens. Ebenso scheint das begreifende Denken, das Gegenstand schlechthin der Wissenschaft der Logik sein soll, in eine Art Allgemeinverständnis eingebettet zu sein, selbst wenn dies nur in der Form sich vollzieht, davon Abstand zu nehmen, jedoch auch gleichzeitig dadurch, dass er ein Allgemeinverständnis benutzen muss, um dies aufzuzeigen: eine andere Art von begreifendem Denken steht für die Einleitung nicht zur Verfügung. Als einer der Hauptverfechter der Dialektik kann sich Hegel dieser Bezugnahme, die einerseits rein negativ, andererseits aber auch positiv ist, nicht erwehren.
Hegels Denken und sein Ausdruck mit dem Medium Sprache bewegen sich von Anfang nach gewissen Gesetzmäßigkeiten, auch in der Einleitung. Sein eigener Anspruch aber, das Regelmaß des Denkens als solches überhaupt erst in der Wissenschaft der Logik zu entwickeln, stellt die Einleitung dazu in eine Status der konzeptionellen Vogelfreiheit. Die Gesetzmäßigkeiten des begreifenden Denkens wie er es intendiert kann er weder voranstellen noch anfangs aufzeigen und ist sich dessen bewusst. Umso kurioser erscheint es, dass er über den dialektischen Umweg trotzdem versucht.
Hegel führt einen Gedanken nach dem anderen an, die allesamt im methodologisch-prinzipiellen Vakuum dieser inneren Inkonsistenz stehen. Zum Beispiel habe die ältere Metaphysik den Vorteil, dass sie nicht das was „an den Dingen erkannt werde das allein an ihnen wahrhaft Wahre“13 hielt, sondern das Denken selbst „nicht ein den Gegenständen Fremdes, sondern vielmehr deren Wesen sei“14 – was sich mit Hegels Selbstbestimmung des Denkens besser verträgt als der bloß „reflektierende Verstand“15, der in bloßen Differenzierungen anhand sachlicher Realität verharrt und solchen allein Wahrheitswert zuordnet, wodurch er keine höhere Wahrheiten sondern nur „subjektive Wahrheit“16 produziert, und „das Wissen zur Meinung“17 reduziert.
Hegel legt die aus heutiger Sicht antike Metaphysik und die aus seiner Sicht modernere Art zu denken zueinander quer: sich nur auf Einzelbestimmungen von Eigenschaften und damit auf unmittelbar gegebene Realität zu verlassen und alle Wahrheit nur dort zu verorten bringt nach Hegel gar keine Wahrheit hervor. Zumindest aber habe sie ein Gutes an sich: dass sie die „Einsicht von dem notwendigen Widerstreite der Bestimmungen des Verstandes“18 beförderte, und so ein Sprungbrett für „den höheren Geist der neueren Philosophie“19 (also auch Hegels eigener) liefert, indem sie, wird die Vielgestalt der weltlichen Dinge und ihre dementsprechend variierenden, differenzierten Repräsentation im Denken anerkannt, der Drang zu Vereinheitlichung an sich getrennter Eigenschaften oder Aspekte entsteht, und so der Vernunft Antrieb zu ihrem Wirken gibt20.
Die Wissenschaft der Logik, die das Versmaß des Denkens überhaupt angeben soll, scheint also historisch als auch konzeptionell nach Hegels eigenem Bekunden gut verwurzelbar zu sein – selbst den aus seiner Sicht rückschreitenden Entwicklungen misst er indirekte Bedeutung zu. Mehr und mehr bindet Hegel damit die Perspektive und damit auch den Maßstab des erst Folgenden, der sich aus sich selbst entwickelnden Kategorienlehre, an eine Vielzahl seiner Philosophie zunächst fremden, äußerlichen Gesichtspunkte. Nötig kann sie diese Ausführungen dem eigenen Anspruch gemäß nicht haben. Sie als überflüssig anzusehen kommt aber schon anhand der gut zwei Dutzend Seiten die er sich damit aufhält ebenfalls nicht in Frage.
Hegels Lehre bewegt sich damit sprachlich als auch konzeptionell in einer Art Zwischenraum. Hätte er die Widersprüchlichkeit seines Vorgehens in der Einleitung explizit gemacht, hätte er sie vielleicht eingeräumt als notwendiges Übel zur Hinführung an seine Lehre. So aber muss die Strapazierfähigkeit des Konstrukts der Hypothek standhalten, dass ihr Verfasser den inneren Absolutheitsanspruch bereits in der Einleitung sowohl affimiert als ihm entgegenwirkt. Genau in diesem Absolutheitsanspruch entpuppt sich die Dialektik des Anfangs: Um den Widerspruch zu vermeiden, müsste eine Differenzierung in Ebenen, Hinsichten oder Bezugseinschränkungen erfolgen. Eben dies versucht Hegel in dem er vorausschickt, dass die Einleitung „nicht den Zweck [habe], den Begriff der Logik etwa zu begründen oder den Inhalt und die Methode derselben … zu rechtfertigen“21 – sondern lediglich „den Gesichtspunkt, aus welchem diese Wissenschaft zu betrachten ist, der Vorstellung näherzubringen“22. Jedoch führt er im Folgenden mehrere Punkte an, die zumindest als Einordnung, Um- und Abgrenzung der Kategorienlehre anzusehen sind, eigentlich aber schon als inhaltlicher Vorgriff und Beschreibung der Methode. Die konzeptionelle Luft für die „Vorstellung“, die er mittels der Einleitung vermitteln will, ist arg dünn anhand dem Anspruch, dass die „Angabe der wissenschaftlichen Methode … [erst] … zu ihrem Inhalte“ gehört.
In Analogie zur Diskussion der Paradoxa aus dem vorangegangenen Teil zeigt sich das Bild, dass durch einen Widerspruch geprägt wird, dessen Auflösung in der Differenzierung von Hinsichten bzw. der Beschneidung von Bezugsräumen bestünde, sofern diese den überhaupt möglich ist: im präsenten Kontext müsste man sich auf Ausflüchte einlassen wie dass das begreifende Denken anfänglich nur allgemein umschrieben wird, ohne seinen eigentlichen Inhalt oder innere Methode zu tangieren, deren Darstellung erst später erfolgt. Damit stünde die Einleitung in einer Art sprachlichen Zwischenraum zwischen voller Gültigkeit und Referenz auf das Folgende, aber auch nicht gänzlich ohne dieselben.
Kurz darauf iteriert Hegel den generellen Impetus der Einleitung noch einmal: „Eine räsonierende Begründung oder Erläuterung des Begriffs der Wissenschaft kann zum höchsten dies leisten, daß er vor die Vorstellung gebracht und eine historische Kenntnis davon bewirkt werde; aber eine Definition der Wissenschaft oder näher der Logik hat ihren Beweis allein in jener Notwendigkeit ihres Hervorgangs“23. Ebenfalls distanziert er sich wiederum vom Vorgehen, wie es seiner Ansicht nach bei anderen Wissenschaften üblich sei: dort könne man sich nur auf das berufen, „was man sich zugegebener- und bekanntermaßen unter dem Gegenstande und Zweck der Wissenschaft vorstellt“24. Dies sei lediglich eine „historische Versicherung“25, und jedem stünde es frei, „etwas mehr und anderes bei diesem und jenem Ausdrucke zu verstehen“26, der sich in der Grundlage der betreffenden Wissenschaft findet.
Wiederum bedient sich Hegel einem Kontrast, den er als den maßgeblichen zwischen seiner Methodik und dem Rest der Wissenschaft ansetzt: wo auf der einen Seite lose Vorstellungen, die lediglich einer mehr oder minder stabilen allgemeinen Übereinkunft entstammen, aber keine Notwendigkeit in sich selbst für sich beanspruchen können, die Grundlage der Wissenschaften ausmachen, entspringt seine Philosophie einer inneren, selbstgesetzen Maßgabe und kann sich deshalb als stabiles Konstrukt behaupten. Genau diese Behauptung steht im scharfen Kontrast zu den Ausführungen die Hegel in der Einleitung unternimmt – konzeptionell eng gebunden dürfen die Erläuterungen darin nicht sein an die nachfolgende Ableitung der Kategorienlehre, da dies deren Eigenständigkeit und innere Geschlossenheit unterminieren würde. Deshalb sind die Vorbemerkungen ebenso als lose Anmerkungen zu erachten, die aber trotzdem eine Vorstellung über den weiteren Verlauf, eine Art groben Aussichtspunkt liefern sollen. Diese lose Verbindung der Einleitung zum Rest steht zumindest in Analogie zu dem, was Hegel konzeptionell missachtet: ein nicht völlig gesichertes Fundament für Methode und Inhalt zu haben.
So ist es nicht verwunderlich, dass Hegel schließlich in mehr oder minder direkten Widerspruch mit sich selbst gerät: die Phänomenologie des Geistes, in der Hegel versucht darzustellen, wie Gegensätzlichkeiten im Denken sich auflösen zu Gunsten eines Systems des sukzessiven Fortschritts des Wissens, stelle „Den Begriff der reinen Wissenschaft und seine Deduktion“27 dar. Dies kontradiktiert die Vorgabe die Hegel am Anfang der Einleitung gemacht hatte: „der Begriff selbst der Wissenschaft … macht ihr [der Logik] letztes Resultat aus; was sie ist, kann sei daher nicht voraussagen“28.
Kreiert man eine Vorstellung von etwas, bestimmt man es zumindest auf gewisse Weise. Irgendetwas fixiert die Vorstellung davon, sonst wäre sie nicht nur überflüssig sondern auch völlig leer und haltlos. Eine Perspektive auf etwas zu schaffen ohne es zu tangieren ist konzeptionell als auch sprachlich nicht möglich. Das sprachliche Vakuum, in dem er sich hier bewegt, lässt sich am Begriff der Vorstellung festmachen. Vorstellung ist bei Hegel zunächst etwas äußeres, was den Dingen zufällt durch zum Beispiel sinnliche Bestimmungen – etwas, das noch nicht den Prozess des Denkens durchlaufen hat. Diese Umgrenzung des Begriffs passt jedoch nicht zu Hegels Vorgehen in der Einleitung, in der er durchaus substantielle Aussagen trifft zu Methode und Inhalt des Folgenden. Den Begriff der Vorstellung, die anfänglich etabliert werden soll, soweit vom Folgenden zu trennen dass er dieses methodisch oder inhaltlich nicht berührt ist nicht möglich. Eine Vorstellung von etwas liefert einen ersten Ansatzpunkt und Umriss für weitere Betrachtungen, also genau den Zweck den eine Einleitung leisten soll. Damit wird aber auch eine entsprechende Grundlage geschaffen auf die sich das Folgende bezieht und damit nicht nur für sich selbst steht.
Die Dialektik des Anfangs trifft Hegel hier auf umgekehrte Art und Weise, der Anfang scheint sein dialektisches Licht zurück in die Einleitung. Hegel will, er darf nach eigener Maßgabe und Anspruch keinen Anfang setzten in der Einleitung und doch muss die Einleitung in irgendeiner Art und Weise ein Anfang sein – schließlich beginnt er die Wissenschaft der Logik damit.
Der Anfang vor dem Anfang
Mittel- und Unmittelbarkeit
Als nächstes stellt Hegel der eigentlichen Kategorienlehre ein weiteres einführendes Kapitel voran, das speziell das Problem des Anfangs bearbeitet. Ein Vermitteltes oder Unmittelbares müsse der Anfang sein, so Hegel. Diese Diskussion schiebt er zunächst auf zugunsten einer Differenzierung des Anfangs als „Prinzip einer Philosophie“29 und einem Anfang „der sich auf die Natur des Erkennens bezieht“30: bei dem einen steht eine einzelne begriffliche Entität im Mittelpunkt, die neben und gleichzeitig durch ihre Funktion als erkenntnistheoretisches Prinzip auch verantwortlich ist für die dinglich Realität der Welt. Beispiele dafür sind „das Wasser, das Eine, Nus, Idee – Substanz, Monade“. Es erscheint nicht ungerechtfertigt, diesen Begriffen eine Anfangsfunktion zuzuschreiben – wegen ihrer zentrale Rolle in den jeweiligen Philosophien, wo jedes Element daraus letztlich auf die jeweilige Begrifflichkeit zurückgeführt wird (was ist die Idee/Substanz/Monade von …?). Bei dem anderen rückt der innere Prozess des Subjekts selbst in den Mittelpunkt und soll als Anfang herhalten: beim „Denken, Anschauen, Empfinden“31. Beide haben nach Hegel gemeinsam, dass bei ihnen „Das Anfangen als solches … als ein Subjektives in dem Sinne einer zufälligen Art und Weise“32 bleibt. In gewissem Sinne heiligt hier der Zweck die Mittel: ganz gleich wo und womit angefangen wird, woher sich der Anfang zusammenstellt und wie – Hauptsache er führt zur Darstellung der philosophischen Theorie und ihrer Begriffe. Der Anfang als solches ist lediglich nur ein nicht weiter herausgehobener Teil und nicht ein Reflektionsproblem an sich. Aber dennoch misst Hegel diesen Philosophien indirekt Bedeutung zu, als eine grundsätzliche Entwicklung dort zu erkennen sei: wo man „zunächst nur für das Prinzip des Inhalts sich interessiert[e]“33, verlegte man sich später darauf, auch das Erkennen selbst als Teil des Erkenntniswerts zu betrachten, „auch das subjektive Tun [wurde] als wesentliches Moment der objektiven Wahrheit erfaßt“34. Nicht nur Gegenstand oder Methode des Erfassens und Begreifens, sondern das Begreifen selbst in den Fokus zu rücken passt in Hegels Formkleid das er für die Kategorienlehre vorgesehen hat.
Nun erfolgt die Erörterung, ob der Anfang nun „entweder als Resultat auf vermittelte oder als eigentlicher Anfang auf unmittelbare Weise“35 zustandekommt. Kurz zuvor hatte er angedeutet, dass er weder das eine noch das andere sein könne36, und erklärt sich jetzt ausführlicher dazu. Zuerst konstatiert Hegel, dass es nichts gäbe, was „was nicht ebenso die Unmittelbarkeit enthält als die Vermittlung, so daß sich diese beiden Bestimmungen als ungetrennt und untrennbar und jener Gegensatz sich als ein Nichtiges zeigt“37. Die Vereinigung von unmittelbarer Gegebenheit und vermittelter ist zentral für die Hegelsche Philosophie – der Prozess des Aufhebens des ersten im zweiten, dessen nochmalige Aufhebung in einem zurückbleibenden Ganzen ist der Algorithmus, mit dem sich Hegel hauptsächlich durch die Instanzen bewegt, seien es die konkreteren Bewusstseinsinhalte der Phänomenologie des Geistes oder die Abstrakta in der Wissenschaft der Logik. Hegel selbst betont, dass diese Untrennbarkeit gelte für jeden logischen Satz, „in welchem die Bestimmungen der Umittelbarkeit und der Vermittlung und also die Erörterung ihres Gegensatzes und ihrer Wahrheit vorkommt“38. Demenstprechend fällt auch der Anfang der Wissenschaft der Logik in diese Kategorie von Sätzen, in denen Unmittelbarkeit und Vermittlung gleichzeitig vorhanden sind.
Problematisch wird diese Charakterisierung des Anfangs anhand des Sprachgebrauchs: „logisch“ soll bei Hegel rein abstrakt bedeuten – aus sich selbst heraus, unaffiziert von äußeren Anhalts- und Verknüpfungspunkten, insbesondere irgendwelchen konkreten Bewusstseinsinhalten. Damit tendiert Hegels „logisch“ in Richtung der Unmittelbarkeit, eines für sich allein stehenden Abstraktums. Gerade aber charakterisierte er das Prädikat „logisch“ als eines, das Unmittelbarkeit und Vermittlung in ihrer Vereinigung bezeichnet. Welches „logisch“ ist das Richtige? Die hier erste Definition von logisch als rein-abstrakt zugunsten der zweiten zu ersetzen funktioniert auch nicht, denn kurz darauf stellt Hegel „logisch“ konträr zu „vermittelt“, und verwendet das Prädikat in der ersten Weise, wenn er sagt: „Logisch ist der Anfang, indem er im Element des frei für sich seienden Denkens, im reinen Wissen gemacht werden soll. Vermittelt ist er hiermit dadurch daß das reine Wissen die letzte, absolute Wahrheit des Bewußtseins ist.“39 Es scheinen sich zwei Bedeutungen von „logisch“ herauszubilden: einerseits logisch als abstrakt und für sich (unmittelbar), andererseits logisch als modus operandi, mit dem der Gegensatz von Unmittelbarkeit und Vermittlung eines konkreten Etwas erörtert wird.
Der inkonsistente Sprachgebrauch zeigt wie schwer sich Hegel damit tut, die Sphären auseinanderzuhalten. Zunächst ist Unmittelbarkeit und Vermittlung überall und an jedem Ding zu finden. So weit so gut – jedes Objekt, das in den Sinnen oder im Denken vorstellbar ist, kann für sich allein als auch in Beziehung zu anderen gesetzt werden. Weiterhin bezeichnet er ein Vorgehen als logisch, das Einzelheiten und Details sowohl bezüglich der Unmittelbarkeit als auch der Vermittlung dieses Objekts aufgreift und ihren Gegensatz erläutert. Alles, wirklich alles hat nach Hegel diese Eigenschaft, auch der Anfang der Logik. Somit ist der Anfang der Logik logisch, als er einen Gegensatz von Unmittelbarkeit und Vermittlung in sich schließt. Das Problem ist, dass der eine Teil dieses Gegensatzes wiederum selbst das Prädikat „logisch“ trägt, als Verortung desselben im reinen Wissen und als Abgrenzung zum Vermittelten. Es ist klar dass „logisch“ nicht als systematischer Überbegriff über „unmittelbar“ und „vermittelt“ stehen kann und gleichzeitig als Substitut von „unmittelbar“.
„Das reine Wissen … ist das Unterschiedslose; … es ist nur einfache Unmittelbarkeit“40. Deshalb sind „logisch“ und „unmittelbar“ praktisch gleichbedeutend, wenn es um den Anfang geht. Logisch ist aber auch jeder Satz aus dem abstrakten Denken, insbesondere einer der „die Bestimmungen der Unmittelbarkeit und der Vermittlung und also die Erörterung ihres Gegensatzes“41 beinhaltet. Indem man also herausstellt, dass der Anfang unmittelbar ist und wie, respektive vermittelt ist und wie, bewegt man sich bereits im Bereich des Hegel-Logischen. Dass der Anfang selbst logisch ist, insofern er im reinen Wissen gemacht wird, ist deshalb problematisch, weil die Logik erst mit ihrem Anfang beginnen sollte – mit der Analyse des Gegensatzes im Anfang, sowohl unmittelbar auch als vermittelt zu sein, hat man also den Anfang bereits hinter sich, ohne im ursprünglich intendierten Sinn angefangen zu haben.
Dieser Zwist ist übersetzbar in eine etwas andere, nicht dermaßen abstrakten Darstellung der Dialektik des Anfangs: diskutiert man den Anfang, wie und wo er gesetzt werden soll und findet man Anhaltspunkte dafür oder auch nur einzelne Bestimmungen davon, hat man den Anfang bereits hinter sich, sofern der Anfang in irgendeiner Art der Beginn einer Reflektion über das Denken ist.
Hegel scheint sich dieses Problems nicht bewusst zu sein. Zumindest aber sieht er den Drang, dass von der „Bestimmung des reinen Wissens aus der Anfang seiner Wissenschaft immanent bleibe“42, auch wenn er dies auf den Begriff des reinen Wissens bezieht, die letzte gewonnene begriffliche Instanz aus der Phänomenologie des Geistes. Das Problem an einem Anfang, der dem nachfolgendem, also dem nachfolgendem Fortschritt in seiner Gänze immanent ist, ist dass Hegel hier explizit Anführungen zu diesem Anfang macht. Wiederum bewegt er sich also in einer sprachlich-konzeptionellen Grauzone, wenn er sagt: „Daß nun von dieser Bestimmung des reinen Wissens aus der Anfang seiner Wissenschaft immanent bleibe, ist nichts zu tun, als das zu betrachten, oder vielmehr mit Beiseitesetzung aller Reflexionen, aller Meinungen, die man sonst hat, nur aufzunehmen, was vorhanden ist.“43 Denn direkt darauf stellt er die zentralen Reflexionen über das reine Wissen an: „Das reine Wissen … hat alle Beziehung auf ein Anderes und auf Vermittlung aufgehoben; es ist das Unterschiedslose; … es ist nur einfache Unmittelbarkeit vorhanden“44.
Hegel möchte hier erreichen, dass der Anfang, den er im reinen Wissen sucht, in der Wissenschaft der Logik bleibt und sonst nirgends. Das ist insofern ein Widerspruch, als das gegenwärtige Kapitel nicht eigentlicher Teil der Wissenschaft der Logik ist, sondern eine anfängliche Diskussion deren Anfangs. Was dort, am Anfang der Wissenschaft der Logik ist, will er aufnehmen, unter Beiseitesetzung aller Reflektionen darüber, also der Anfang im Abstrakten, im reinen Wissen – um dann einige Reflektionen darüber anzustellen. Sprachlich als auch konzeptionell ist dies nicht möglich, ohne in Kontradiktion mit sich selbst zu geraten.
Mikroskopisch könnte man den Widerspruch schon im Begriff des reinen Wissens selbst verorten: es „hat alle Beziehung auf ein Anderes und auf Vermittlung aufgehoben“ – was an sich selbst eine Bestimmung ist, auch wenn rein negativ. Aber Hegel geht noch einen Schritt weiter: „es ist das Unterschiedslose; dieses Unterschiedslose hört somit selbst auf Wissen zu sein; es ist nur einfache Unmittelbarkeit vorhanden“45. Wenn das reine Wissen so unbestimmt und abstrakt ist, dass es aufhört überhaupt Wissen zu sein, steht Hegel nun terminologisch mit leeren Händen da: es bleibt kein Begriff mehr übrig, an dem er anknüpfen könnte – nur das einfache, vollkommen Unterschiedslose und von allen Bezügen getrennte.
Was folgt ist eine Art Kunstgriff aus dem dialektischen Repertoire Hegels: „Die einfache Unmittelbarkeit ist selbst ein Reflexionsausdruck und bezieht sich auf den Unterschied vom Vermittelten“. Nachdem das reine Wissen so in sich zusammengegangen ist, dass es begrifflich dimensionslos, punktförmig und damit nicht mehr greifbar wurde (ohne „alle Beziehung auf ein Anderes und auf Vermittlung“ wird es genau das), zieht Hegel den Knoten wieder auseinander. Wo zuerst alle Bestimmung gegen etwas anderes, aller sonstiger Bezug abgeschnitten war, bestimmt er nun die einfache Unmittelbarkeit als ein Abstraktum, das sich ergibt, stellt man sich den Gegensatz von allem was vermittelt ist vor. Nach der begrifflichen Implosion des reinen Wissens glaubt Hegel nun den Freiraum gewonnen zu haben um zu sagen: „In ihrem wahrem Ausdrucke ist daher diese einfache Unmittelbarkeit das reine Sein“46.
Die Frage bleibt zurück, ob es, selbst für jemanden der mit Widersprüchen arbeitet so wie Hegel möglich sein kann, so viele Widersprüche in kurzer Zeit anzuhäufen ohne dass das ganze Konstrukt ins Wanken kommt. Zuerst bewegt er sich auf dem schwierigen Terrain, das schon die vorangegangene Einleitung bestimmt hatte: zu dem expliziten Zweck hin, den Anfang der eigentlichen Ausführung des Themas immanent zu gestalten, bestimmt er den Anfang im Vorhinein. Dann setzt er an mit dem Begriff des reinen Wissens mit der Bemerkung, nur aufnehmen zu wollen was vorhanden ist, ohne aller Reflexionen, um fast im selben Atemzug dieses Vorhaben zu konterkarieren. Noch innerhalb dieses Prozesses strengt er sich an, den Begriff, der die ganze Wissenschaft der Logik umfassen soll, den diese darstellen soll, das reine Wissen, dialektisch zu nivellieren so dass nur „einfache Unmittelbarkeit“ zurückbleibt. Dieser Spielzug scheint recht ad-hoc gemacht: Hegel muss zum reinen Sein, der ersten Kategorie der Wissenschaft der Logik gelangen, und dafür muss das reine Wissen zur Seite treten.
Um den Übergang vom reinen Wissen zum reinen Sein zu rechtfertigen, steht lediglich ein Analogieschluss zur Verfügung: „Wie das reine Wissen nichts heißen soll als das Wissen als solches, ganz abstrakt, so soll auch reines Sein nichts heißen als das Sein überhaupt; Sein, sonst nichts, ohne alle weitere Bestimmung und Erfüllung.“47 Diese Herleitung steht auf schwachen Füßen. Zum einen könnte man, in Analogie zum reinen, abstrakten, von allem Inhalt gelösten Wissen mehrere Kandidaten einer neuen Kategorie einsetzen, die den Anfang machen soll, insofern man sich nur auf die Analogie eines rein abstrakten Etwas benutzt, etwa der Form nach: „sowie das reine Wissen von aller konkreten Bestimmung gelöst ist, so ist ebenfalls das reine … ganz abstrakt, nur für sich genommen“. Zum anderen stellt sich die Frage, warum nicht das Nichts als Korrelat des reinen Wissens auserkoren wird, das die logischere Wahl zu sein scheint, wenn das reine Wissen so unterschiedslos und ohne Vermittlung auf Anderes sein soll, dass es gar kein Wissen mehr selbst ist. Bleibt dann nicht einfach Nichts übrig?
Möglicherweise lässt sich Hegels Vorgehensweise hier durch einen Seitengriff auf die Selbstbezüglichkeit des Anfangs ein Stück weit rechtfertigen. Schließlich ist der Anfang, oder besser, wird er sein: Hegel wird ein paar Seiten später den Anfang setzen. Rein intuitiv ist schwer einsehbar, wie das Nichts als erste Kategorie einen validen Anfang darstellen soll, schon allein des Sprachgebrauchs halber: er würde ganz wörtlich mit Nichts anfangen. Da Hegel mit dieser Art von Selbstbezug operiert, wäre es wohl sehr schwer, einen Fortgang abzuleiten, stünde er anfangs mit den leeren Händen des Nichts da. Dieser Gedankengang scheint zumindest teilweise auch bei Hegel anzuklingen: „Soll aber keine Voraussetzung gemacht, der Anfang selbst unmittelbar genommen werden, so bestimmt er sich nur dadurch daß es der Anfang der Logik des Denkens für sich, sein soll. Nur der Entschluß, den man auch für eine Willkür ansehen kann, nämlich daß man das Denken als solches betrachten wolle, ist vorhanden.“48 Hier entsteht deutlich eine Leerstelle: Hegel kann nicht umhin, eine Entschlossenheit zum ganzen Unternehmen vorauszusetzen, woher auch immer diese kommen mag. Im folgenden Satz, der eine Schlüsselstelle der Reflektion über den Anfang ist, erklärt er sich weiter: „So muß der Anfang als absoluter, …, abstrakter Anfang sein; er darf so nichts voraussetzen, muß durch nichts vermittelt sein …“49 Auf anderem Wege wie die obige Idee kommt Hegel, auch wenn er es nicht explizit macht, deshalb zwar nicht zum Ergebnis des Nichts, aber er lässt es anklingen: entnimmt man diesem Satz die Hilfsverben und erlaubt sich die Großschreibung, bleibt übrig: „der Anfang setzt Nichts voraus, ist durch Nichts vermittelt“. Auch wenn diese Reformulierung den Satz und seinen Sinn in eine andere Richtung lenkt scheint sie doch nicht ganz ungerechtfertigt zu sein – außerdem bedient sich Hegel etwas später desselben Stilmittels50. Das reine Wissen, von dem die Überlegung ausging, ist so absolut und unmittelbar wie Hegel hier den Anfang umreißt; schließlich war es so bar jeder Vermittlung, dass es einfache Unmittelbarkeit ist. Dadurch scheint sich das Nichts, das übrig bleibt, auch wenn es Hegel hier nicht im Sinn hat, als kategorialer Kandidat für den Anfang durch sich selbst zu empfehlen. Dem steht entgegen, dass der Anfang auch irgendwie sein muss: „Er muß … ein Unmittelbares sein“51. Also geht die Überlegung, die zuerst zum Nichts als Anfang tendiert und aus pragmatischen Gründen wieder von ihm weg in gewissem Gleichklang mit Hegels Gedankengang an dieser Stelle: es ist die pure Notwendigkeit einen Anfang zu machen, ihn zum Sein zu bringen. Die systematische Rechtfertigung dafür aber steht auf einem anderen Blatt, insbesondere da unter Verwendung des Selbstbezugs die Nadel wieder Richtung des Nichts ausschlägt: „Wie er nicht gegen Anderes eine Bestimmung haben kann, so kann er auch keine in sich, keinen Inhalt enthalten, denn dergleichen wäre Unterscheidung von Verschiedenem aufeinander, somit eine Vermittlung. Der Anfang ist also das reine Sein.“52 Die Schlussfolgerung des letzten Satzes erscheint zu stark formuliert: das reine Sein könnte den Anfang machen, anhand dieser Beschreibung aber auch das Nichts.
Hegel ist sich der Neigung des Anfangs zum Nichts durchaus bewusst, auch wenn er es nicht an dieser Stelle, sondern einige Seiten später anführt: „Es ist noch Nichts, und es soll Etwas werden. Der Anfang ist nichts das reine Nichts, sondern ein Nichts, von dem Etwas ausgehen soll … Der Anfang enthält also beides, Sein und Nichts; ist die Einheit von Sein und Nichts“53. Hegel bedient sich hier derselben grammatischen Transformation die oben gemacht wurde und schreibt „Nichts“ und „Etwas“ groß im ersten Satz dieser Passage. Das Problem dabei ist zwiespältig: zwar erkennt er das Nichts an, als im Anfang auch bereits gesetzt, greift damit aber, was auch die Großschreibung bestätigt, nicht nur der ersten Kategorie, sondern auch der zweiten vor. Außerdem widerspricht er sich selbst wenn er sagt: „das Anfangende ist noch nicht; es geht erst dem Sein zu.“54 Dadurch dass er das Anfangende gerade beschrieben hat, ist es schon, zumindest in irgendeiner, vielleicht unvollständiger, vorläufiger Art und Weise, durch das bloße Faktum, dass es hier geschrieben steht. Hegel benutzt hier die Kursivstellung von „ist“, wie es häufig vorkommt wenn die Bezugsebenen aufeinanderprallen; er scheint das Sein des Anfangs durch den Unterschied in der Skriptur aus dem präsenten Kontext herausnehmen zu wollen, es davon unterscheiden zu wollen. Unterschiedliche Schreibweisen allein aber lösen den Widerspruch, die Dialektik des Anfangs nicht auf.
Zurückkehrend zur vorigen Textstelle hat Hegel noch zwei weitere Probleme in diesem Absatz im Gepäck. Erstens setzt er darin voraus, dass „der Anfang selbst unmittelbar genommen werden“ soll. Aber dadurch, dass der Anfang das reine Sein vermittelt, kontradiktieren sich Prämisse und Schlussfolgerung. Zweitens tritt hier die notorische Schwachstelle im gesamten System der Wissenschaft der Logik auf: jede Einzelaussage in obigem Satz widerspricht sich selbst . Der Anfang bzw. das reine Sein soll
- nicht gegen Anderes sowie sich selbst eine Bestimmung haben ↔ außer genau dieser der Bestimmung
- keinen Inhalt zu enthalten ↔ außer genau diesen Inhalt.
Ein analoges Problem durchsetzte schon die Einleitung zur Logik der Wissenschaft; dort bestand es darin, dass Abgrenzung und Umriss der Thematik im Ganzen, als auch des Anfangs im Besonderen im Widerspruch standen zur Selbständigkeit derselben. Hier verdichtet sich die Problematik in Einzelaussagen, betrachtet man, wie sich diese auf sich selbst beziehen. Wie bei den Paradoxa stellt sich die Frage nach der semantischen Geschlossenheit: ist der Selbstbezug notwendig und unumgänglich, hat der Widerspruch Bestand. Will man ihn vermeiden, bleibt nur die Möglichkeit, die semantische Geschlossenheit einzuschränken; beispielsweise indem man in verschiedene sprachliche Ebenen differenziert. So könnte man etwa anführen, dass der Bezugsrahmen einer Kategorie wie dem reinen Sein ein grundsätzlich anderer ist als der einer Beschreibung einer Kategorie – dass sich beide auf konzeptionell, systematisch, sprachlich oder sonstwie verschiedenen Ebenen bewegen, und diese Diskrepanz beachtet werden muss. In diesem Sinn würde man den Selbstbezug den Kategorien erlauben (denn ohne diesen würde das gesamte Hegelsche System nicht funktionieren), aus den Beschreibungen der Kategorien dürften aber keine Rückschlüsse auf dieselben gezogen werden, so dass die obigen Widersprüche nicht deduziert werden können. Dass diese Differenzierung in Bezugsebenen nicht Hegels intendiertem sprachlich-konzeptionellem Konstrukt entsprechen kann, ist deshalb klar, weil er selbst eine Schlussfolgerung aus den Beschreibungen trifft: „Der Anfang ist also das reine Sein“55 – Rückschlüsse auf die Kategorien sind also erlaubt. Weiterhin könnte man einwenden, dass es genau diese Dialektik ist, die das Hegelsche System ausmacht: die Selbstbewegung durch den Widerspruch, und dass deshalb dieses Vorgehen legitim ist in seinem Sinn. Dieses Gegenargument hat durchaus Gewicht, aber trotzdem wäre es wünschenswert gewesen, dass Hegel dies dann auch so kenntlich gemacht hätte, etwa nach folgendem Muster: „indem der Anfang keine Bestimmung hat, findet er seine Bestimmung als reines Sein“. Es ist jedoch durchaus vorstellbar, dass Hegel diese Dialektik absichtlich nicht explizit gemacht hat, weil sich dann ein neues Problem stellt, nämlich dass gerade eine Ableitung einer Kategorie stattgefunden hat per Aufhebung, also mittels eines Widerspruchs – ein Algorithmus der nicht in die Anfangsdiskussion gehört sondern zur Kategorienlehre selbst, und damit wiederum in Widerspruch mit sich selbst gerät, weil der Anfang dann nicht nur aus dem reinen Sein, sondern aus Analyse des reinen Wissens und des Anfangs als unmittelbaren selbst entsteht und somit der Anfang nicht das reine Sein, sondern die Gesamtheit dieser Betrachtungen ausmacht.
Besonders am Anfang tritt diese Problematik deutlich heraus – Hegel ist systematisch bereits gebunden an ein System, das sich erst im späteren Verlauf entwickelt. Dieses System soll ein in sich geschlossenes Bezugssystem darstellen. Der Anfang kann daher nur, wie er selbst konstatiert, unmittelbar erfolgen, muss quasi vor die Nase gesetzt werden. In gewissem Sinne versucht Hegel aus dieser Schwäche eine Stärke zu machen, indem er daraus eine Kategorie ableitet. Nimmt man diese Ableitung aber ernst im systematischen Sinn, dann hat der Anfang des Systems bereits vor dem eigentlichen Beginn statt, denn die erste Kategorie ist deduziert worden: „Hier ist das Sein das Anfangende, als durch Vermittlung … entstanden dargestellt“56. Darüber hinaus leitet er dieselbe Kategorie nochmals aus der Unmittelbarkeit des Anfangs ab und bestärkt damit, abgesehen von der inneren Problematik dieser zweiten Ableitung, noch einmal die Dialektik des Anfangs, der bereits geschehen ist, bevor er passieren soll.
Akzeptiert man die problematische Herleitung des reinen Seins durch das reine Wissen, akzeptiert man weiterhin auch die direkten Widersprüche bei der Ableitung des reinen Seins über den unmittelbaren Anfang, bleibt immer noch die Dialektik des Anfangs bestehen.
Anfang, Ende, Kreis
Sowohl in der Einleitung als auch bei der Diskussion des Anfangs finden sich immer wieder Passagen, die anklingen lassen, dass sich Hegel den angesprochenen Schwierigkeiten halbgradig bewusst zu sein scheint: „Nach dieser einfachen Darlegung dessen, was zunächst nur zu diesem selbst Allereinfachsten, dem logischen Anfang gehört, können noch weitere Reflexionen beigebracht werden“57. Zweimal benutzt er „einfach“ in diesem Satz – was anhand der Schwierigkeit des bisherigen Textes als auch seines Volumens untertrieben erscheint. Man kann weiterhin vermuten, dass der Deminutiv nachträglich den bereits erfolgten Vorgriff auf die Kategorienlehre abschwächen und so die systematische Ordnung ein wenig wiederherstellen soll. Zudem ist Hegel noch nicht fertig mit den Vorbemerkungen, und wie in der Einleitung schickt er den nächsten Erläuterungen einen Absatz voraus, der versichern soll, dass diese nicht systematisch notwendig wären, sondern quasi nur der Ergänzung halber angeführt werden: „doch können sie [die folgenden Reflexionen] nicht sowohl zur Erläuterung und Bestätigung jener Darlegung, die für sich fertig ist, dienen sollen, als sie … durch Vorstellungen … veranlaßt werden, die uns zum voraus in den Weg kommen können, jedoch wie alle anderen vorangehenden Vorurteile, in der Wissenschaft selbst ihre Erledigung finden müssen, und daher eigentlich zur Geduld hierauf zu verweisen wäre.“58 Ähnlich wie obiges „einfach“ klingt das „eigentlich“ hier fast schon apologetisch; als wäre er sich der Dialektik des Anfangs mehr oder weniger bewusst, und deshalb versucht zu relativieren.
Dennoch dient das Folgende der weiteren Analyse eines Anfangs, der bereits geschehen ist. Hegel betrachtet den Anfang nun in seiner Beziehung zum Fortschritt davon und zum Ende: man könne der Ansicht sein, „daß das Vorwärtsgehen ein Rückgang in den Grund, zu dem Ursprünglichen und Wahrhaften ist, von dem das, womit der Anfang gemacht wurde, abhängt und in der Tat hervorgebracht wird“59. Mit der Einsicht, warum der Anfang so gewählt wurde wie er gewählt wurde, die ein gutes Stück später oder erst am Ende erfolgt, also mit der Übersicht die man erringt, verknüpft sich die Einsicht, dass der Anfang dem Ganzen systematisch untergeordnet ist, also abhängig davon ist.
Dieser Gedankengang stellt ein recht effektives Argument für die Dialektik des Anfangs dar. Wenn einmal das Prinzip des Fortgangs in einem System verstanden und zur Gänze entwickelt ist, lässt sich einsehen, welche Rolle der Anfang darin spielt und warum der Anfang gerade der ist der er ist. Je nachdem wie stark der logische Bezug der Einzelelemente im System ist, wie kohärent das System ist, lassen sich vom Ende weg die Schritte zurückverfolgen bis an den Anfang, so dass man den zeitlichen Verlauf auch umkehren könnte, so dass „das Erste auch das Letzte und das Letzte auch das Erste wird.“60 Hegel kommt damit zum Bild des Kreises für die Gesamtheit des Systems, da Anfang und Ende miteinander verknüpft sind.
Hegel versucht aus dieser Betrachtung einige Schlussfolgerungen zu ziehen: „Durch diesen Fortgang denn verliert der Anfang das, … ein Unmittelbares und Abstraktes … zu sein; er wird ein Vermitteltes“61. Dadurch dass am Ende, so Hegel, „das Resultat erst als der absolute Grund hervortritt, ist das Fortschreiten … nicht etwas Provisorisches, sondern es muß durch die Natur der Sache und des Inhaltes selbst bestimmt sein.“62 Diese Konsequenzen wiederum projiziert er auf die vorhin erfolgte Ableitung des Anfang als des reinen Seins: „So ist vorhin der Grund, warum in der reinen Wissenschaft vom reinen Sein angefangen wird, unmittelbar an ihr selbst angegeben worden“63 – woraufhin er fortfährt und nochmals die Unmittelbarkeit des reinen Seins als Anfang und seine Vermittlung durch das reine Wissen wiederholt.
Einerseits ist diese Übertragung der Dialektik von Anfang und Ende auf die Herleitung des reinen Seins über das reine Wissen gar nicht möglich, denn reines Sein bzw. reines Wissen markieren beide den Anfang der Wissenschaft der Logik und keiner das Ende. Zu argumentieren, das reine Wissen sei das Ende der Phänomenologie des Geistes und das reine Sein der Anfang der Wissenschaft der Logik, und weil beide korrelieren, würde zwar der Dialektik und und ihrem Abbild als Kreis Rechnung tragen, aber nichts für die Herleitung eines Anfangs für die Wissenschaft der Logik einbringen: Wissen und Sein würden einen Kreis bilden, der für sich abgeschlossen ist und keine Weiterleitung zu anderen Kategorien ermöglicht.
Zwar spiegelt der Kreis als Bild die Dialektik des Anfangs wieder, aber im Grunde nur deren innere Problematik: in einem Kreis gibt es keinen ausgezeichneten Punkt, jeder ist dem anderen gleich, und damit auch keinen Anfang und kein Ende – er ist in sich geschlossen, und deshalb hilft die Vorstellung nicht dabei, den Anfang zu begründen. Setzt man das Bild ein für den Gesamtverlauf der Wissenschaft der Logik, von der ersten bis zur letzten Kategorie, unterminiert es Hegels gegenwärtiges Unterfangen, den Anfang herzuleiten und zu rechtfertigen, denn alles was er hier zu sagen hat steht außerhalb des Kreises.
Deshalb ist es nur folgerichtig, dass Hegel sich darauf verlegt, die Möglichkeit eines Anfangs ganz ohne alle Vorrede oder Einleitung zu diskutieren: „Aber auch die bisher als Anfang angenommene Bestimmung des Seines könnte weggelassen werden, so daß nur gefordert würde, daß ein reiner Anfang gemacht werde.“64 Diese Perspektive führt auf die bereits zuvor angeführten Erkenntnisse: „Es ist noch Nichts, und es soll Etwas werden. Der Anfang ist nicht das reine Nichts, sondern ein Nichts, von dem Etwas ausgehen soll; das Sein ist also auch schon im Anfang enthalten. Der Anfang ist also beides, Sein und Nichts“65.
Diese Analyse trifft zwar eine scheinbar einfache Dialektik des Anfangs, macht aber die Sachlage noch komplizierter als es vorher war. Der Anfang ist noch nicht, zumindest nach Hegels Ermessen, deshalb enthält er das Nichts. Aber es soll ein Anfang gemacht werden: deshalb spielt auch das Sein in den Anfang ein. Dies ist die Dialektik der einen Seite des Anfangs – bevor dieser gemacht wird. Das Problem dabei ist das immer wiederkehrende, dass dadurch der Anfang bereits gemacht wurde: die beiden ersten Kategorien müssen schon dafür herhalten, den Anfang zu umschreiben, müssen des Anfangs willen vorgezogen werden. Man könnte entgegnen, dass Hegel hier zwar Sein und Nichts erwähnt, aber nicht in dem Sinn wie sie später als Kategorien aufgeführt werden. Dann aber würde sich das Sein aus dem Begriff des Anfangs herleiten, der Anfang selbst also vielleicht selbst die erste Kategorie sein – auf jeden Fall aber wäre das Sein nicht der Anfang. Darüber hinaus zeigt sich zur anderen Seite noch eine Art von Dialektik: wenn der Anfang gemacht ist, hat er zwar sein Sein. Aber er soll Anfang von etwas Weiterführendem sein, was noch nicht ist. Das, was noch nicht ist, muss aber gemäß obiger Betrachtung schon in seinem Sein verankert sein, weil der Anfang sonst auf nichts anderes führen würde. Sein und Nichts sind also wiederum im Anfang vereint. Damit führt die Analyse auf eine mehrfache Dialektik von Sein und Nichts im Anfang.
Hegel aber versucht die letztere Dialektik umzudrehen zu seinen Gunsten: „Aber der Anfang soll nicht selbst schon ein Erstes und ein Anderes sein; ein solches, das ein Erstes und ein Anderes in sich ist, enthält bereits das Fortgegangensein. Was den Anfang macht, der Anfang selbst, ist daher als ein Nichtanalysierbares, in seiner einfachen unerfüllten Unmittelbarkeit, also als Sein, als das ganz Leere zu nehmen.“66 Hegel will also die Dialektik des Anfangs zu sein, im Sinn eines gesetzten Anfangs, der gleichzeitig nicht ist, weil er als Anfang noch nicht auf das Folgende führte, nicht anerkennen, sondern leitet gerade aus deren Verneinung, indem er die Seite des Nicht-Fortgegangenen betont, das Sein ab als Anfangskategorie. Weil der Anfang zunächst nur allein für sich steht, und nicht bereits das weiterhin Folgende in sich schließt, ist anfangs nur schlicht gegeben: er ist ein leeres Sein.
Wieder einmal leitet Hegel das Sein her, diesmal direkt aus dem Begriff des Anfangs selbst. Dadurch verschwinden aber die Schwierigkeiten nicht: zuerst einmal hat Hegel das übliche Problem der Referenz seiner Bemerkungen auf sich selbst. Den Anfang stellt er hier dar als ein Nichtanalysierbares, Leeres – aber hat ihn gerade damit analysiert und bestimmt, und bestimmt ihn weiterhin als das Sein. Zweitens operiert er hier nicht direkt mit dem Anfang, der ja das reine Sein sein soll, sondern mit dem Begriff des Anfangs. Dadurch holt er sich eine zweite Kategorie mit an Bord: der Anfang vermittelt sich selbst durch seinen Begriff. Gerade durch die Negation des Anfangs als etwas das vermittelt auftritt und einen weiteren Fortgang vermittelt, bekommt der Anfang als Begriff, als Kategorie systematisches Gewicht – er führt auf eine neue Kategorie, das reine Sein, und zwar mittels der Negation als dem üblichen Hegelschen Arbeitsprinzip. Darüber hinaus ist durch beide Problematiken die Dialektik des Anfangs in der bereits mehrmals aufgeführten Form gegeben: der Anfang ist gemacht vor dem intendierten Anfang.
[es fehlt: Anfang mit Ich und Einteilung des Seins]
[Schlussbemerkung zum Anfangen vor dem Anfang: mittels Einschränkungen der Bezüglichkeiten/Geltungsräume – Aufspalten in Hinsichten, Einschränken der semant. Geschl. kann Dialektik des Anfangs scheinbar umgangen werden – Hegel versucht es auf viele Arten und scheitert.]
Schlussbemerkungen
Hegel macht eine gründliche Analyse des Anfangs, insbesondere diskutiert er mehrere Ansatzpunkte und dreht und wendet den Anfang für den er sich entscheidet, das reine Sein, nach allen Seiten um ihn zu betrachten. Gerade wegen der Differenziertheit seiner anfänglichen Betrachtungen ist es kaum verständlich, dass ihm nicht selbst aufgefallen ist, oder wenn doch, warum er nicht deutlich kenntlich macht, wie antithetisch sein Tun zu seinen Worten steht. Er betrachtet den Anfang zu jeder Seite hin, und jede dieser Seiten führt, bezieht man sie auf sich selbst, auf mindestens den Widerspruch, den Anfang vorwegzunehmen. Dass der Anfang ein Problem ist, dessen ist sich Hegel hochbewusst. Dass seine Erläuterungen dazu problematisch sind jedoch nicht.
Es gäbe verschiedene Ansätze, den Widerspruch herauszurechnen aus der Diskussion des Anfangs, doch leiden alle diese unter dem Makel, die semantische Geschlossenheit einzuschränken, und zwar ungerechtfertigterweise. So gründet sich das Problem meist in den Erläuterungen, und nicht so sehr in den Kategorien selbst, wodurch man zum Beispiel verleitet werden könnte zu behaupten, der Rückbezug auf sich selbst wäre nur den Kategorien gestattet und nicht den Erläuterungen – denn diese seien lediglich ergänzendes Beiwerk und dürften keine systematischen Impulse geben. Einerseits ist diese Ansicht ad-hoc angesetzt, um die Kontradiktion umschiffen zu können. Andererseits schließt Hegel selbst auf die Kategorien zurück anhand seiner Anmerkungen, weshalb dieser Ausweg ausgeschlossen werden kann.
Trotzdem hat Hegel auf eine gewisse Art und in gewissem Maß das Anfangsproblem für sich gelöst: Der Anfang hat das Sein und das Nichts in sich: „Es ist noch Nichts, und es soll Etwas werden“. Hier leitet sich aus dem Begriff des Anfangs selbst die Dichotomie von Sein und Nichts ab, und es stellt sich die Frage, warum Hegel nicht den Begriff des Anfangs zur Kategorienlehre selbst dazuzählt – damit ließen sich viele Probleme vermeiden und der Anfang wäre durch sich selbst, nämlich seinen Begriff gesetzt. Vielleicht wäre dieser Anfang Hegel zu pragmatisch gewesen? Er will im reinen Denken beginnen, losgelöst von konkretem Inhalt und gesonderter Spezifikation. Der Begriff des Anfangs mag nicht so allumfassend sein wie der des reinen Seins – rein als Begriff genommen wäre er aber zunächst fern allen Inhalts und aller Bestimmungen. Danach würde er dadurch konkretisiert, dass Sein und Nichts aus ihm hergeleitet werden würden, und er seine Funktion als Kategorie wahrgenommen hätte. Also würde aus der abstrakten Betrachtung, was ein Anfang ist, die Dichotomie von Sein und Nichts folgen, wodurch die Kategorie „Anfang“ aufgehoben wäre im Sinne Hegels in Sein und Nichts, indem sie sich selbst einen Inhalt gibt, eben diese Dichotomie, und dann der Anfang schon – quasi unmerklich – passiert wäre. Die Herleitung von Sein und Nichts aus einem völlig abstrakten Begriff von Anfang hebt diesen auf, weil er durch seine Implikation von Sein und Nichts Umriss und Konkretisierung erhält, und sich dadurch selbst hinter sich lässt, als der Anfang – widersprüchlicherweise, dialektischerweise – innerhalb seiner selbst selbst sein Ende findet, der Anfang sich selbst erledigt: Die Dialektik des Anfangs würde Hegel helfen, wenn er sie denn benutzen würde. Somit gibt es zwar kein Entkommen vor dem Widerspruch – aber er kann produktiv verwendet werden. Hegel kann insgesamt nur eine teilweise Lösung des Anfangsproblems zugesprochen werden; das Material dafür sammelt er sich zwar, aber benutzt nicht den Rückbezug desselben auf sich.