Platons Dialektik lässt sich mit am Besten am Beispiel seines “Parmenides” erfahren. Lange war dieser Dialog einer der am wenigsten und schlechtesten verstandesten Klassiker der Philosophie, und hat in unserer Zeit so etwas wie eine Renassaince erfahren. Wer sich also in eines der tiefsten metaphysischen Wasser begeben will, und einen der schwierigsten Texte verstehen will, den die Philosophie jemals hervorgebracht hat, der sei im Folgenden mit einer ersten Einleitung zu Platon und dem Parmenides bedacht (das ganze Buch gibts hier zum Download). Wer eine – wirklich hervorragende – Sammlung von Essays vieler Autoren zu Platons Metaphysik, und auch zum Parmenides sucht, dem sei das folgende Buch ans Herz gelegt:
- Studies in Plato’s Metaphysics, zusammengestellt von R.E. Allen, herausgegeben von Routledge & Kegan Paul Ltd, London 1965.
====== 0. Einleitung ======
Platon macht es den Lesern des Parmenides nicht gerade einfach. Die Gründe hierfür wollen wir an dieser Stelle kurz darstellen, beginnend bei den generellen Schwierigkeiten, die sich für den modernen Leser bei der Lektüre Platons auftun, fortschreitend zu einem Anriss derer, die speziell die Lektüre des Parmenides erschweren.
===== 0.1 Platon als Systemdenker =====
Sung-Jin Kim bemerkt in seiner Untersuchung „Der Widerspruch und das Urteil in Platons Parmenides“: „Alle Dialoge, besonders aber die späten, bezeugen uns Platon eher als Problemdenker denn als Systemdenker“ . Platon entwickelt in seinen Dialogen keine fortlaufend gegliederte philosophische Doktrin – der Zusammenhang der Thematiken der einzelnen Dialoge erschließt sich erst über die Lektüre mehrerer Dialoge hinweg. Sein Denken ist ganz auf die verschiedenen Problemstellungen abgerichtet – die inhaltlich-systematische Kohärenz zwischen diesen herzustellen bleibt zu einem nicht unwesentlichen Teil dem Leser überlassen. Weiterhin tauchen auch dieselben oder ähnliche Themen in verschiedenen Dialogen und damit unterschiedlichen Kontexten auf. So taucht beispielsweise der sowohl dem platonischen Denken als auch dieser Untersuchung zentrale Begriff der Dialektik in mehreren Dialogen und in verschiedenen Zusammenhängen auf: außer im Parmenides beispielsweise auch noch im Sophistes, im Philebos, im Phaidros oder in der Politeia. Die Methodik, ähnliche Problematiken in verschiedenen Bezügen zu diskutieren, ist philosophisch legitim und hat auch ihre Vorzüge, vor allem, dass durch verschiedene Blickwinkel reichhaltigere Erkenntnis über eine Thematik gewonnen werden kann – dem Leser erschwert sie aber zunächst das Verständnis, weil sie einerseits eine Synthetisierungsleistung der unterschiedlichen Perspektiven von ihm erfordert und andererseits die Frage aufwirft, welcher nun (Platons Überzeugung nach) der richtige Denkansatz für ein spezielles Problem sei. Dementsprechend kommt auch diese Arbeit, die sich auf den Parmenides konzentriert, bei dessen Analyse nicht ohne Verweise auf andere Dialoge aus. Trotz dieses inter-dialogischen Gedankengeflechts vertritt sie aber die grundsätzliche These, dass Platons Parmenides als eine thematische Einheit aufgefasst werden kann, in der die Problemstellungen inhaltlich geschlossen behandelt werden.
===== 0.2 Die Vielgestaltigkeit des Begriffes der Dialektik =====
Der Begriff der Dialektik findet sich nicht bloß in vielen Dialogen, er findet sich auch in unterschiedlichen methodischen Ausprägungen. Wiederum teilt sich Platons Werk: in den frühen Dialogen taucht die διαλεκτική (τέχνη), die (Kunst der) Unterredung, im Sinne ihrer etymologischen Wurzel dialegesthai [griechisch!], ein Gespräch zu führen, auf – Dialektik bedeutet hier die wechselseitige, verschieden Positionen gegenüberstellende Diskussion einer Thematik durch meist zwei Gesprächspartner. In den späteren Dialogen, insbesondere den schon erwähnten Phaidon, Politeia, Phaidros und Sophistes, erhebt sich die Dialektik zum zentralen methodischen Moment von Platons Lehre – Dialektik impliziert nun die gegenseitige Durchdringung der Ideen, durch die Erkenntnis entsteht. Dadurch wird ihre in zweierlei Hinsicht eine neue Rolle zugeschrieben: einerseits besitzt sie eine Rückwirkung auf die Methodik des gedanklichen Fortschrittes: weil die Ideen sich gegenseitig beeinflussen, muss diese Durchdringung auch ihren Niederschlag im gedanklichen Vorgehen finden. Andererseits ist sie gerade deshalb auch zentraler Bestandteil von Platons philosophischer Doktrin. Insgesamt entwickelt sich die Dialektik Platons also von einem formalen Strukturelement der Dialoge hin zu einer inhaltlichen Triebfeder des Diskurses und avanciert damit auch zum Teil von Platons philosophischer Lehre. Durch diese verzweigte Ambivalenz des Begriffes der Dialektik und seinen Rückfluss auf die platonische Methodik öffnet sich ein weiter exegetischer Raum für verschiedene Möglichkeiten zur Interpretation und auch zur Kritik an Platons Vorgehen.
===== 0.3 Logik und Dialektik =====
W. Risse schreibt im Historischen Wörterbuch der Philosophie : „Dialektik heißt bei Platon Logik, soweit sie von ihm ausgebildet ist. Sie befaßt sich mit der Analyse und der Synthese von Begriffen … und dient vornehmlich der Erkenntnis des Seienden, um die Ideen zu begreifen.“ Dialektik und Logik lassen sich bei Platon der Sache nach nicht voneinander unterscheiden. Das deduktiv gültige Vorgehen ist bei Platon deshalb bereits das dialektische Vorgehen – im Kontrast zu unserem heutigen Verständnis von Logik und Dialektik . Beide stellen Systeme von Schlussregeln dar, spätestens jedoch entzweien sie sich am Begriff des Widerspruchs . Während die Dialektik gemeinhin den Widerspruch als notwendiges Element anerkennt, gilt es in der Logik, zumindest der klassischen, den Widerspruch zu vermeiden. Dementsprechend warnt J. Stannard zu Recht vor dem Versuch , Platons Denken „voreilig mit den Begriffen der modernen Logik … zu identifizieren, oder sie in die … formalisierte Methode hineinzuzwängen“ . Freilich bieten sich die vielfach aufgeführten, engmaschigen Schlussketten im Parmenides dafür geradezu an – dennoch ist eine gewisse Vorsicht geboten, um einerseits nicht griechische Begriffe mit solchen aus den modernen Zeiten der Philosophie gleichzusetzen, mit denen sie nicht unbedingt übereinstimmen, und um andererseits auf Platons Grundhaltung nicht unberücksichtigt zu lassen, nach der Logik und Dialektik dem Wesen nach kongruieren.
Bedenkenswert ist auch, dass unser heutiges Dialektikverständnis, wenn auch über die Geschichte hinweg modifiziert, dennoch „im Grunde auch mit diesem Dialog erst beginnt, so daß es auch nicht ausgeschlossen werden kann, daß sich unser Dialektikverständnis dem Dialog [dem Parmenides; Anm. d. Autors] gegenüber als moderne Voreingenommenheit herausstellt.“ Zwischen Platons Auffassung von Logik und der modernen befinden sich zweifellos einige Gräben, insbesondere der des Widerspruchs. Jedoch muss das nicht notwendigerweise bedeuten, dass das heutige das richtigere ist, insbesondere wenn es Anwendung auf einen platonischen Dialog finden soll. Bemerkenswert ist in diesem Sinne auch, dass es in der modernen Logik Strömungen gibt, die versuchen, produktiv mit Widersprüchen umzugehen, indem diese für sie als logisch gültig annehmbar sind und so in eine moderne, formale Systematik eingeordnet werden können. In einem gewissen Sinne gliedert sich dadurch die Logik wieder in die Dialektik ein (oder umgekehrt) – zumindest stehen sie sich nicht mehr antipodisch gegenüber. Mit dieser Spielart der Logik, der parakonsistenten Logik, werden wir uns im Laufe dieser Untersuchung noch weiter auseinandersetzen. Weil durch diese Form von Logik die Trennung zwischen ihr und der Dialektik entschärft wird, liegt der Gedanke nahe, einen Vergleich zwischen ihr und dem parmenideischen Schlussweisen zu versuchen. Für den Moment bleibt jedoch festzuhalten, dass die Anwendung moderner logischer Hilfsmittel zunächst nur mit einiger Vorsicht von statten gehen sollte. Die Fragen danach, wo diese Vorsicht notwendig wird, inwiefern sie dort berechtigt ist, inwiefern Platons Begriffe von Logik und Dialektik für die moderne Zeit relevant sind und welche Perspektive aus dem heutigen Verständnis von Logik und Dialektik im Vergleich zu Platons logisch-dialektischen Vorgehen abgeleitet werden kann, bilden die zentrale Problemstellung dieser Arbeit. Dementsprechend steht nicht so sehr die Anwendung moderner logischer Systematiken auf das parmenideische Gedankengut im Vordergrund als der Versuch, Parallelen respektive Unterschiede zwischen ihnen zu untersuchen und diese bezüglich ihres philosophischen Problemgehalts zu analysieren.
===== 0.4 Die Interpretationen des Parmenides =====
Der Parmenides nimmt eine gewisse Sonderstellung innerhalb von Platons Gesamtwerk ein. Kein anderer Dialog hat ein so weit gefächertes Spektrum an Auslegungen hervorgerufen. Die Kontroverse bezüglich der Interpretation seines philosophischen Gehalts und bezüglich seiner Einordnung ins platonische Gesamtwerk dauert bis heute an. Die Palette an unterschiedlichen Lesarten und Exegesen reicht von … bis … Dennoch scheint, besonders in der neueren Zeit, so etwas wie eine Entwicklung in der Parmenides-Interpretation stattgefunden zu haben : die parmenideische Dialektik „gewinnt gerade in unserer Zeit auch von der formal-logischen und linguistischen Seite her immer wieder Anerkennung statt Disqualifizierung.“ Besonders im englisch-sprachigen Raum fanden und finden moderne Autoren Problematiken im Parmenides wieder, die philosophisch nicht von der Hand zu weisen sind – so fand G. Ryle im Parmenides eine platonische Typentheorie vor, so dass er die Behauptung aufstellte: „ … the dialogue is philosophically serious, in the sense … that its arguments were valid that its problem was one of philosophical importance“ . W.G. Runciman folgerte aus seiner Sichtweise des Parmenides: „ [the] moral is both more than the need for dialectical gymnastics and less than the the abandonment of the theory of forms; … that the dialogue can accordingly be seen as a coherent and serious whole.” G. Vlastos erkannte die Relevanz des Problem des “tritos anthropos” oder des “third-man” in seiner Vollständigkeit, R.E. Allen bemühte sich, mit analytischen Mitteln die logische Gültigkeit der parmenideischen Schlussfolgerungen zu beweisen, und dadurch deren philosophische Bedeutung herauszustellen . Insgesamt tendiert die Entwicklung in der Parmenides-Exegese fort von … und hin zu einer Auffassung, die sowohl den Schlussketten als auch den dargelegten Problematiken im Parmenides grundsätzliche Richtigkeit respektive philosophisches Gewicht beimisst. Die vorliegende Arbeit sieht sich in ebenfalls in dieser Tradition. Als eine Art programmatische Zusammenfassung könnten die Thesen, die ihr zu Grunde liegen, in etwa folgendermaßen aufgestellt werden:
* Platons Parmenides ist weder ein Witz, noch ein Glasperlenspiel mit dem Leser, noch sophistischer Unsinn; er ist auch keine grundsätzliche Widerlegung der Ideenlehre. * Die meisten der von Parmenides angeführten Schlussketten bzw. die diskutierten Problematiken besitzen philosophische Relevanz. * Der Parmenides ist eine als Ganzes ernstzunehmende und inhaltlich geschlossene Diskussion einer grundlegenden philosophischen Problematik. * Die Divergenz der Interpretationen des Parmenides resultiert teilweise daher, dass der Parmenides solchen Lesarten gegenüber resistent ist, die in wenigen Worten Zusammenfassung finden sollen. Dies rührt (unter anderem) von der Komplexität der in ihm behandelten Thematik her. * Die Frage danach, welcher der dem Dialog teilnehmenden Figuren Platons eigene philosophische Position reflektiert, kann nicht mit einer eindeutigen Festlegung auf einen einzelnen Gesprächsteilnehmer beantwortet werden. * Die Tatsache, dass der Dialog in unaufgelösten Aporien endet, kann nicht als reductio-ad-absurdum-Beweis gegen die Ideenlehre verwendet werden. Die vorgestellten Kontradiktionen unterstreichen erst die Tiefe der dargestellten philosophischen Problematiken und öffnen einen Horizont für weitergehende Fragestellungen. * Dass nach der Feststellung der Aporien der Dialog abbricht und diese unkommentiert bezüglich ihrer inhaltlichen Einordnung ins platonische Gesamtwerk bleiben, kann höchstens als Platons Eingeständnis verstanden werden, keine finale Antwort auf die diskutierten Problemstellungen anbieten zu können, und nicht als wortlose Resignation. * Einige der Problemhorizonte, die sich im Parmenides auftun, sind bis heute von unverminderter Aktualität und Relevanz. Allerdings hat die moderne Philosophie neue, Platon freilich unbekannte Mittel hervorgebracht, um diese anders, vielleicht auch besser, behandeln zu können.
Eine These fehlt hier, nämlich die Annahme, dass der Parmenides ein genuines Werk Platons ist. Mit dieser Frage wollen wir uns nicht beschäftigen . Die übrigen Thesen müssen freilich erst erwiesen werden. Um ein erstes Gefühl dafür zu vermitteln, wie diese Untersuchung an den Text des Parmenides herangehen will, lassen wir diese Thesen zunächst beiseite und gehen stattdessen, zumindest für den Anfang, nur von einer Prämisse aus, die unumgänglich erscheint: es ist klar ersichtlich, dass im Parmenides einige Grundzüge der Ideenlehre kommentiert, mögliche Einwände und Schwächen diskutiert werden, und die philosophische Problematik später an einem Exempel festgemacht wird. Der Parmenides ist der einzige Dialog Platons, der eine „äußere“, kritische Perspektive auf die Ideenlehre einnimmt: Nachdem Parmenides im ersten Teil des Dialogs mehrere Einwände gegen die Ideenlehre vorgebracht, und auch jede Gegenantwort seines Gegenübers, dem jungen Sokrates, zu entkräften gesucht hat, fragt er: „Was also willst du tun in Hinsicht der Philosophie?“ Und weiter: „Wohin willst du dich wenden, wenn du über diese Dinge [die seienden Begriffe, die uns Erkenntnis vermitteln können, also die Ideen; Anm. d. Autors] keine Erkenntnis besitzt?“
Die Folgerung, dass die Ideenlehre im Parmenides kritisch beleuchtet wird, wollen wir als die „minimale Lesart“ des Parmenides bezeichnen: denn sie beinhaltet (noch) keine Wertung von Parmenides Position in irgendeiner Hinsicht, weder in Bezug auf die Richtigkeit ihrer Argumente, noch in Bezug auf das Gesamtverständnis von Platons restlichem Denken; sie stellt lediglich fest, dass im Parmenides die Ideenlehre von einem äußeren Standpunkt betrachtet wird. Sie impliziert auch keine Stellungnahme zu der Frage, welcher der Gesprächspartner im Dialog Platons eigene Meinung repräsentiert.
Die meiner Ansicht nach „maximale Lesart“ von Platons Parmenides besteht darin, anzunehmen, wie bereits in der letzten Grundthese angerissen, dass die Kritik, die Parmenides im ersten Teil des Dialogs an der Ideenlehre übt, zumindest zum Teil berechtigt ist, und die dialektische Ausformung einer Idee im zweiten Teil dazu dient, der Kritik mehr Gewicht durch ihre Explifikation zu geben, sie gleichzeitig allerdings auch um in einer Weise darzustellen, so dass sie die philosophische Substanz und die grundlegende Problematik dahinter möglichst klar zu Tage fördert; und dies nicht, um etwa die Ideenlehre zurückweisen zu können, sondern um mögliche Missverständnisse auszuräumen, Misskonzeptionen der platonischen Lehre vorzubeugen oder den Horizont für weitergehende, möglicherweise noch ungelöste Problemfelder zu öffnen. Am Ende dieser Untersuchung hoffe ich, genug Belege für eine Lesart zusammengestellt zu haben, die sich in etwa in der Mitte dieser beiden Extreme befindet.
Alle anderen Lesarten halte, besonders die, nach denen der Parmenides sophistischer Unsinn, … , … oder … ist, halte ich für ungerechtfertigt. Weder hier noch im Zuge dieser Untersuchung werden aber Gründe dafür angegeben werden, warum diese nicht richtig sein können. Vielmehr konzentriert sich diese Analyse darauf, positive Gründe für eine Interpretation des Parmenides innerhalb der Grenzen der minimalen und maximalen Lesart anzuführen. Die übliche Unterteilung des Dialogs in einen ersten Part, in dem einige grundlegende Problematiken bezüglich der Ideenlehre diskutiert werden, und den zweiten Teil, der sich mit einer dialektischen Ausformung einer konkreten Idee befasst, behalten wir eher aus traditionellen und formalen denn aus inhaltlichen Gründen bei. Dass der Dialog ein thematisch geschlossenes Ganzes darstellt, ist schließlich eine der Thesen, die plausibilisiert werden sollen.
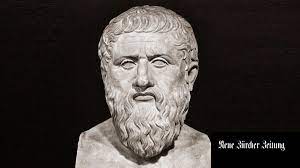
Es wird von einer Untersuchung gesprochen, von der hier offenbar nur die Einleitung vorliegt – sollte dann nicht auch die Untersuchung zugänglich gemacht oder zumindest bibliografisch identifiziert werden?
Siehe oben im Artikel den Link zum Download ganzen Abhandlung!
Danke, das hatte ich übersehen!
Für Interessierte noch zwei Dissertationen:
http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000010091/Dissertation-Sein_und_Erkennen.pdf?hosts (Kang Liu, Diss 2011)
http://www-brs.ub.ruhr-uni-bochum.de/netahtml/HSS/Diss/MalmsheimerArne/diss.pdf (Arne Malsheimer, Diss 1999)
Für meine Marmenides-Lektüre habe ich systematisch Hilfsmittel im Netz gesucht; was ich gefunden habe, habe ich hier zusammengestellt:
http://philoso42.wordpress.com/2014/02/25/platon-parmenides-lesen-hilfsmittel/